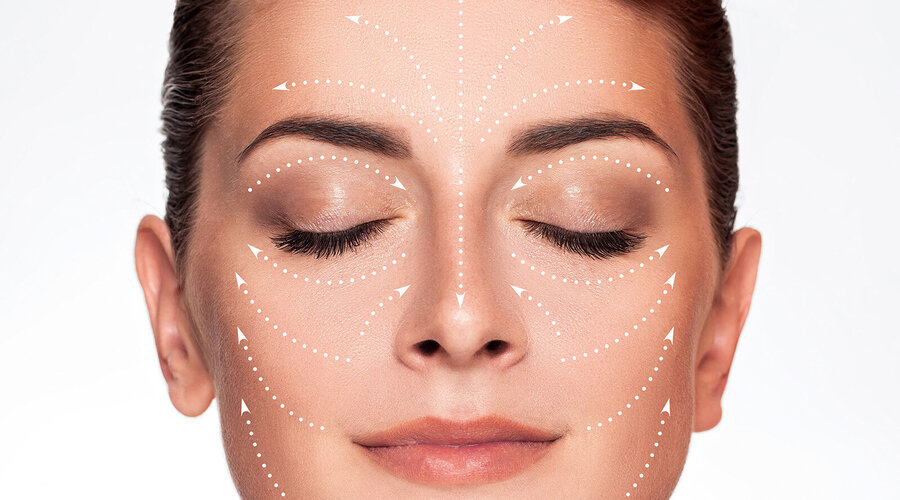Wird die Kopfhaut sichtbar, verändert sich trotz kosmetischer Bemühungen die äußere Erscheinung ganz erheblich, was das Selbstbild der Betroffenen erheblich attackiert. Auch seelisch setzt diese Veränderung enorm zu. Ab wann spricht man von Haarausfall? Kopfhaarfollikel gehören zu den zellteilungsfreudigsten Geweben des menschlichen Körpers. Jedes der 80 bis 120 Tausend Kopfhaare durchläuft einen immer wiederkehrenden Wachstumszyklus, der aus drei Phasen besteht: der Anagen-, Katagen- und Telogenphase.
Es ist also ganz natürlich, pro Tag zwischen 50 und 100 Haare zu verlieren. Nur bei einer Haarwäsche können es schon mal mehr sein. Etwa ab dem 25. Lebensjahr lichtet sich der Schopf, denn jetzt fallen mehr Haare aus als nachwachsen können. Aber auch das ist noch kein Grund zur Beunruhigung. Erst wenn mehr als drei Monate lang an mindestens zehn haarwäschefreien Tagen mehr als 100 Haare täglich ausfallen, spricht man von Effluvium, Alopezie.
Ursachen
- endokrine Faktoren wie etwa Schilddrüsenerkrankungen, Wechseljahre, Absetzen der Pille, übermäßiger Milchfluss nach der Geburt, Vermännlichung durch Defekte der Nebennierenrinde
- internistische Erkrankungen wie z.B. Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen durch einseitige Diäten, Diabetes mellitus, Infektionen, Autoimmunerkrankungen, ungenügende Gefäßversorgung, Mikroentzündungen
- medikamentöse Faktoren wie etwa Blutgerinnungshemmer, Magensäurebildner, Cholesterinsenker, Zytostatika I Umweltbelastungen (Lösungsmitteldämpfe, Staub, Ruß, extreme Hitze)
- chemische Beanspruchung wie z.B. häufiges Färben oder Dauerwellen I mechanische Belastung wie etwa zu straff gebundenes Haar
- seelische Probleme, Schockerlebnisse oder Dauerstress
Forscher rätseln allerdings noch immer, ob der weiblichen Alopezie eine genetische oder hormonelle Komponente zugrunde liegt. Gehört sie doch zu der am meisten verbreiteten Form des Haarverlustes, der androgenetischen Alopezie.
Charakteristische Anzeichen
Es fallen vermehrt Haare aus, die in der Katagenphase sind. Die Folge ist eine diffuse Ausdünnung des gesamten Kopfhaares (Alopecia diffusa), die Stirn-Haar-Grenze weicht zurück – die so genannten „Geheimratsecken“ entstehen – oder die Scheitelregion verbreitert sich. In der Regel liegt jedoch keine Störung der Kopfhaut vor. Noch normal wachsende Haare finden sich neben kleinen Wollhaaren. Zum Glück kommt es bei der Frau auch bei fortschreitender Form selten zur Glatzenbildung. Ein solcher Haarausfall ist meist auf Störungen des Allgemeinzustandes der Betroffenen zurückzuführen. Die Wachstumsphase des Haares verkürzt sich auf weniger als ein Jahr und die Haare fallen schneller aus.
Typen weiblichen Haarausfalls
Androgenetische Alopezie – Unter dieser am häufigsten vorkommenden Form des Haarausfalls leiden Frauen vor oder während der Menopause ebenso darunter wie junge Frauen während der Schwangerschaft oder sogar junge Mädchen mit extremen Hormonschwankungen. Es gibt bei Frauen keinen Altersgipfel. Vielmehr ist der Höhepunkt der Häufigkeit plateauartig und reicht bis zum 40. Lebensjahr. Wahrscheinlich weil andere Formen des Haarausfalls dazukommen.
Kreisrunder Haarausfall – Die Alopecia areata beispielsweise beruht auf einer immunbedingten Haarwurzelentzündung; sie zeigt sich durch kreisrunde, eng abgegrenzte Kahlstellen. Die Haut ist nicht atrophisch, die Follikelöffnungen sind erhalten. In ihnen erkennt man kleine, depigmentierte Miniaturhaare. Gelegentlich findet man auch nur rudimentär entwickelte Haare (Kadaverhaare) als schwarze Punkte in den Follikelöffnungen. Man geht davon aus, dass es sich um eine Autoimmunkrankheit handelt. Der kreisrunde Haarausfall tritt plötzlich auf und kommt am häufigsten im Kindesalter vor. In 20 Prozent der Fälle sind noch andere Familienangehörige davon betroffen. Auch psychischer Stress soll Schüben der Alopecia areata vorangehen. In den meisten Fällen stellt sich früher oder später wieder neuer Haarwuchs ein (Spontanremission).
Haarausfall bei Mangelzuständen (Stoffwechsel, Kachexie, maligne Tumoren oder HIV) – Diese Form ist nur zu beheben, wenn die Grunderkrankung abgeheilt ist oder eine entsprechende Operation erfolgreich verlaufen ist. Da Haarfollikel eine hohe regenerative Potenz haben, können sich bereits 4 – 6 Wochen nach überstandener Erkrankung neue Haarschäfte auf der Kopfhaut zeigen. Gelegentlich erhält das Haar beim Wiederwachstum eine andere Textur. Eine zusätzliche medikamentöse Stimulation des Haarwachstums ist in der Regel nicht nötig. Bleibende Defekte lassen sich durch plastisch-operative Maßnahmen beheben.
Narbiger Haarausfall – Dieser Typus ist nicht auf weibliche Patientinnen begrenzt. Er wird durch Verbrennungen oder Verätzungen hervorgerufen. Die haarbildenden Zellen sind zerstört. Es kann kein neues Haar nachwachsen. Hier helfen nur Haarteile oder Perücken über den Schaden hinweg.
Was kann man tun?
Um zu verhindern, dass aus einer milden Form der Alopezie ein ausgeprägter Haarausfall mit durchscheinender Kopfhaut wird, sollte man frühzeitig die Ursache abklären und eine wirksame Behandlung beginnen. Ein Hautarzt klärt in einem ausführlichen Gespräch die Lebensumstände der Patientin, ordnet eine mikroskopische Untersuchung von Kopfhaut, Haaren, Haarwurzeln, Nägeln und Haut und eine Blutanalyse an. Denn am Zustand der Haarwurzeln (Trichogramm) kann der Experte erkennen, ob die Haare aufgrund von Medikamenteneinnahme ausfallen, oder ob eine Entzündung der Haarwurzeln vorliegt. Die Blutuntersuchung gibt Aufschluss darüber, ob hormonelle oder internistische Störungen zugrunde liegen. Die Therapieplanung erfolgt langfristig und berücksichtigt die zeitlichen Abläufe des Haarwachstumszyklus. Wundermittel sind leider nicht vorhanden.
Aufbau des Haares
Das Haar wird unterteilt in Haarwurzel und Haarstamm (sichtbarer Teil). Der untere Teil der Haarwurzel wird auch Haarbulbus genannt. Die Haarwurzel wird von dem Haarfollikel umschlossen. In dessen oberem Teil befinden sich die für die Haarentwicklung verantwortlichen Stammzellen. In den Haarfollikel münden eine bzw. mehrere Talgdrüsen, auch Schweißdrüsen.
Helga Freytag, Institut für ganzheitliches Gesundheitsmanagement, 60311 Frankfurt
Du siehst die Vorschau
Sind Sie Premium- oder Digital-Abonnent? Dann melden Sie sich mit Ihrem my BEAUTY FORUM Konto an, um diesen Inhalt sehen zu können.
Noch kein BEAUTY FORUM Konto?
Abonnenten benötigen ein persönliches Konto, um geschützte Online-Inhalte sehen zu können. Bitte führen Sie die Registrierung durch.
RegistrierenTest-Abonnement
Sie können unser Angebot auch 3 Monate kostenfrei testen.
Anmelden
Mit bestehendem Benutzerkonto anmelden.