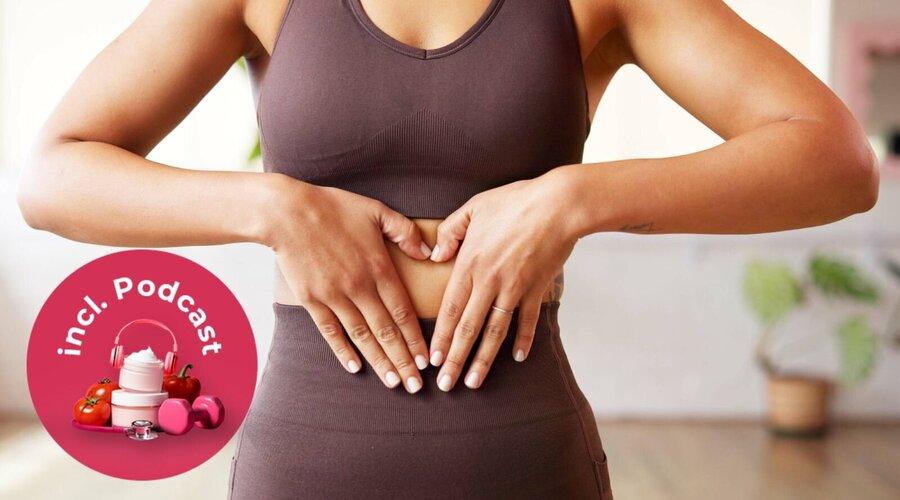Körperflüssigkeiten gelangen von der Natur geplant oder unbeabsichtigt auf die Haut und lösen unterschiedliche Reaktionen und Empfindungen aus. Aus der Nähe betrachtet haben manche von ihnen ganz interessante Eigenschaften, die es wert sind, sich intensiver mit ihnen zu beschäftigen.
Unser Körper nimmt Stoffe aus Nahrung und Luft auf, verstoffwechselt sie unter Energiegewinnung in Form von Wärme und Bewegung und scheidet die Reaktionsprodukte wieder aus. Neben diesem „Mainstream“ gibt es weitere, mit Ausnahme des Urins vergleichsweise geringe Ausscheidungen mit vielfältigen Funktionen, die auch auf die Haut gelangen.
Sebum
Das Sebum wird von Natur aus auf der Haut verteilt und gehört zu ihrem Schutzprogramm. Über die Fettsäurechemie des Sebums, das von den Talgdrüsen ausgeschieden wird, ist erst vor Kurzem im Detail berichtet worden.1
Entgegen früherer Annahmen enthält das Sekret beim Verlassen der Drüsen noch keine freien Fettsäuren.2 Freie Fettsäuren wie Sapiensäure (16:1 n-10) zu etwa 25 Prozent und Sebaleinsäure (18:2 n-10) entstehen offensichtlich in den Haarfollikeln erst durch Lipasen des Mikrobioms. Das von den Haarfollikeln ausgeschiedene Sebum enthält:3
- 30–50 Prozent Glyceride,
- 15–30 Prozent Freie Fettsäuren,
- 26–30 Prozent Wachsester,
- 12 Prozent Squalen,
- 3–6 Prozent Cholesterinester,
- 1.5–2.5 Prozent Cholesterin
Ziel der Hautpflege sollte es sein, das natürliche Gleichgewicht zwischen Sebum, den Lipiddoppelschichten der Hautbarriere und der Hautflora so wenig wie möglich zu stören und so weit wie möglich zu fördern.
Ohrenschmalz
Ohrenschmalz alias Cerumen enthält die Substanzgruppen, die im Sebum vorkommen, allerdings in anderen Konzentrationen und ist deshalb hochviskos bis wachsartig. Zum Beispiel liegt der Cholesterinanteil bei etwa 21 Prozent. Abweichend vom Sebum besitzt Ohrenschmalz etwa 19 Prozent Ceramide.4 Er wirkt anti-mikrobiell gegen fakultativ pathogene Keime des Hautmikrobioms,5, 6 unter anderem aufgrund antimikrobieller Peptide (AMP).7 Eine porentiefe Reinigung des Gehörgangs mit Wattestäbchen ist daher nicht empfehlenswert.
Muttermilch
Muttermilch ist praktisch isotonisch zum Blut und besitzt einen pH-Wert, der anfangs schwach basisch (Kolostrum) und später mehr oder weniger neutral ist (pH-Wert 7). Der Wassergehalt beträgt etwa 90 Prozent. Im Wasser befinden sich Salze inklusive Spurenelemente sowie Kohlenhy-drate (zum Beispiel Lactose) und Fette (zum Beispiel Triglyceride und freie Fettsäuren), die durch Proteine und Phospholipide wie Phosphatidylcholin emulgiert werden.
Zu den Proteinen gehören unter anderem Abwehrstoffe wie Immunglobuline, Lysozym und Lactoferrin. Sehr viele weitere Komponenten sind beschrieben.8, 9
Muttermilch, verarbeitet zu kosmetischen Produkten, wäre sehr gut für die Hautpflege geeignet, wenn sie nicht von den Neugeborenen benötigt würde. Als gleichwertiger Ersatz gilt heute noch die Stutenmilch.
Schweiß
Hauptaufgabe der ekkrinen Drüsen ist die Temperaturregulation, während die apokrinen Drüsen durch ihre zusätzlichen organischen Komponenten im Zusammenspiel mit der Bakterienflora der Haut die charakteristische Duftnote des einzelnen Menschen bestimmen.10
Der ekkrine Schweiß besteht zum größten Teil aus Wasser neben Salzen wie Natrium- und Kaliumchlorid sowie kurz- und mittelkettigen Carbonsäuren. Der pH-Wert liegt bei etwa 4,5. Größere Schweißmengen, bei Sport11 und hohen Temperaturen etwa, führen zum Aufkonzentrieren der Salze bis hin zu ihrer Kristallisation auf der Hautoberfläche. Soweit die Hautbarriere intakt ist, ist das kein Problem. Im Gegenteil, der Salzanteil des NMF (Natural Moisturizing Factor) wird gegebenenfalls sogar unterstützt.
Im Falle von medizinischen Hautindikationen, wie zum Beispiel der Rosacea, verursacht der entstehende hohe osmotische Druck jedoch Reizungen. Gleiches kennt man von offenen Wunden.
Auch unter normalen Verhältnissen reizt der Schweiß, wenn er von der Stirn in das Auge tropft – ein Grund, beim Sport ein Stirnband zu tragen.
Andererseits gelangt das antimikrobielle Peptid Dermcidin (DCD) aus den Schweißdrüsen als Breitband-antibiotikum an die Hautoberfläche. DCD-Fragmente erzeugen Ionen-kanäle in Bakterienmembranen und lassen das Membranpotenzial zusammenbrechen. Zinkionen (Zn2+) wirken synergistisch. Im Schweiß von Neurodermitikern, die häufiger an Infektionen leiden, kommen DCD-Fragmente in vergleichsweise geringer Konzentration vor.12
Auch Lysozym, das zum Immunsystem gehört, wurde im Schweiß gefunden.
Der in wesentlich geringerer Menge entstehende apokrine Schweiß ist im Gegensatz zum ekkrinen, sauren Schweiß praktisch pH-neutral. Er enthält unter anderem auch lipophile und Protein-Komponenten und besitzt eine höhere Konsistenz.
Tränenflüssigkeit und Tränenfilm
Die Tränenflüssigkeit variiert je nach Anlass in ihrer Zusammensetzung, enthält hauptsächlich Salze wie Natriumchlorid und ist im Gegensatz zum sauren Schweiß schwach basisch (pH-Wert 7,4). Der osmotische Druck (Osmolarität) entspricht nahezu einer isotonischen Kochsalzlösung. Auch Tränenflüssigkeit hat eine leicht reizende Wirkung, wenn sie sich durch Wasserverdunstung aufkonzentriert.
Interessant ist, dass sie in Spuren langkettige Fettsäuren wie Palmitin-, Öl-, -Linolen- und Arachidonsäure enthält.13 Das ist nicht verwunderlich, findet man doch in der Lipidschicht des natürlichen Tränenfilms, der das Gleiten der Augenlider über den Feuchtefilm ermöglicht, vor allem Phospholipide in Form von Phosphatidylcholin neben Triglyceriden und Cholesterin sowie dessen Estern. Der Tränenfilm wird durch ein Zusammenspiel der talgabsondernden Meibomschen Drüsen, der Tränendrüsen und der Schleimdrüsen der Bindehaut mit dem Lidschlag auf der Augenoberfläche erzeugt.
Bei einem unzureichenden Tränenfilm entsteht die medizinische In-dikation des „trockenen Auges“. Adjuvant kosmetische Lotionen, die auf die geschlossenen Lider gesprüht werden, sind bei der symptomatischen Behandlung hilfreich.14 Sie enthalten liposomales, natives Phosphatidylcholin, das zusammen mit isotonischer Kochsalzlösung und Schleimstoffen wie Hyaluronsäure über die Lidkante auf den Tränenfilm spreitet. Reizungen und Spannungsgefühle werden reduziert.
Speichel
Wie Schweiß und Tränenflüssigkeit besteht der Speichel bis auf etwa 0,5 Prozent anderer Stoffe nur aus Wasser. Neben Salzen und der □-Amylase, die Polysaccharide wie Stärke spalten kann, sind vor allem Lysozym, Lac-toferrin, Immunglobuline, schleim-bildende Glykoproteine und Histatine zu erwähnen. Letztere wirken antibakteriell, antientzündlich, entfalten ihre Wirkung über die kationische Aminosäure Histidin und werden daher sogar in Form eines externen Gels bei Zahnfleischentzündungen eingesetzt.15
Da Histatine allgemein im Speichel von Säugern vorkommen, hat die Redewendung „Wunden lecken“ für die Behandlung von Verletzungen in der Tierwelt eine große praktische Bedeutung. Darüber hinaus bewirkt Speichel eine Beschleunigung der Blutgerinnung.16 Angeblich soll das Küssen auch das Immunsystem stärken.
Der pH-Wert des Speichels variiert um den Neutralpunkt herum zwischen 6,5 – 7,2.
Urin
Urin hat ebenfalls einen zwischen sauer und schwach basisch stärker variierenden pH-Wert von 4,6 – 7,5, abhängig von der Nahrungsaufnahme. Die Konzentration der enthaltenen Stoffe17 hängt von der Flüssigkeitsaufnahme ab und kann zwischen hypotonisch und hyper-tonisch schwanken.
Eine wichtige Funktion ist die Ausscheidung von wasserlöslichen stickstoffhaltigen Verbindungen, die Ammoniak an Amide gebunden enthalten – Harnstoff (Urea), Harnsäure (Purin-Derivat) und Kreatinin. Ammoniak kann man in der Nähe von Urinalen durch seinen Geruch wahrnehmen, wenn Harnstoff durch das Enzym Urease in Kohlendioxid (CO2) und Ammoniak (NH3) zerlegt wird.
Vor allem hypertonischer Urin ist ein Auslöser der Windeldermatitis, wenn er auf eine geschädigte Hautbarriere trifft beziehungsweise Hygiene in Form von tensidhaltigen Reinigungsmitteln übertrieben wird. Eine so weit wie mögliche Umstellung auf die reinigende Pflege mit geeigneten pflanzlichen Ölen kann Abhilfe schaffen.
Was sonst noch so fließt …
Weitere Körperflüssigkeiten haben überaus komplexe Zusammensetzungen und verbleiben unter Umständen für Stunden auf der Haut:
- Vaginalsekret: Der tiefe pH-Wert von etwa 3,5 – 5,0 ist auf den Anteil von Milchsäure zurückzuführen.
- Samenflüssigkeit (Ejakulat) besitzt einen pH-Wert zwischen etwa 7 und 8 und ist somit schwach basisch.
- Menstruationsflüssigkeit enthält eine Mischung aus Blut, Vaginal-sekret, Scheidenflora und Bestandteilen aus der Gebärmutter.
- Blut ist schwach basisch (pH-Wert 7,4). Der Wassergehalt beträgt etwa 90 Prozent, Proteine sind mit 8 Prozent vertreten – neben Salzen und Kohlenhydraten.
Nasensekret18 ist von unterschiedlicher Konsistenz, leicht sauer und enthält Lysozym und andere antimikrobielle Peptide (AMP), die gegen Bakterienund pathogene Pilze wirksam sind. - Die Sekrete bilden durchweg kein Problem für die Haut, sofern sie nicht im Intimbereich über längere Zeit in einen Wärme- und Feuchtestau (enge Kleidung, Einlagen) kommen, der ihren Abbau durch Mikroorganismen begünstigt. Hygienetücher und Intimsprays eignen sich aufgrund ihrer Zusammensetzungen nicht als Hilfsmittel.19 Empfehlenswert sind eher Einmalwaschlappen, die vor dem Toilettengang angefeuchtet werden.
Literatur:
1 H. Lautenschläger, Langweilig oder spannend? Eine Reise durch die Fettsäure-Chemie der Haut, Chemie in unserer Zeit, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ciuz.202400008 (8. November 2024)
2 C. L. Fischer and P. W. Wertz, Skin Microbiome Handbook: From Basic Research to Product Development, Chapter 11: Effects of endogenous lipids on the skin microbiome, Wiley Online Library (14. August 2020)
3 M. Picardo, M. Ottaviani, E. Camera and A. Mastrofrancesco, Sebaceous gland lipids, Dermatoendocrinol. 1 (2), 68–71 (2009)
4 J. T. Bortz, P. W. Wertz, D. T. Downing, Journal of the American Academy of Dermatology 23 (5), Part 1, 845–849 (1990)
5 S. Gupta, R. Singh, K. Kosaraju, I. Bairy, B. Ramaswamy, A study of antibacterial and antifungal properties of human cerumen, Indian Journal of Otology 18 (4), 189–192 (2012). DOI: 10.4103/0971-7749.104796
6 K. Ambika Devi, B. K. M. Lakshmi, P. V. Ratnasri, K. P. J. Hemalatha, Antimicrobial activity of cerumen, Current Research in Microbiology and Biotechnology 3 (4), 670–680 (2015)
7 M. Schwaab, A. Gurr, A. Neumann, S. Dazert, A. Minovi, Human antimicrobial proteins in ear wax. In: Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 30 (8), August 997–1004 (2011)
8 https://www.hebammen-bw.de/wp-content/uploads/DHV_Muttermilch_Inhaltsstoffe.pdf
9 https://assets.pubpub.org/uzc39ub6/61653059177599.pdf
10 H. Lautenschläger, Schweiß und Körpergeruch – den emotionalen „Duft“ in Schach halten, Beauty Forum 2004 (4), 48–50
11 L. B. Baker, Sweating Rate and Sweat Sodium Concentration in Athletes: A Review of Methodology and Intra/Interindividual Variability, Sports Med 47 (Suppl 1), 111–128 (2017)
12 M. Paulmann, T. Arnold, D. Linke, S. Özdirekcan, A. Kopp, T. Gutsmann, H. Kalbacher, I. Wanke, V. J. Schuenemann, M. Habeck, J. Bürck, A. S. Ulrich, B. Schittek, Structure-activity analysis of the dermcidin-derived peptide DCD-1L, an anionic antimicrobial peptide present in human sweat, The Journal of Biological Chemistry 287 (11), 8434–8443 (2012)
13 B. S. Khyshiktuev, P. P. Tereshkov, S. A. Kozlov, L. A. Golub, M. V. Maksimenia, Fatty acid constitution of the lachrymal fluid in healthy subjects and in patients with ophthalmopathology, Klinicheskaia Laboratornaia Diagnostika, 2005 (4), 18–19 (russisch)
14 H. Lautenschläger, Kosmetische Präparate gegen trockene und müde Augen, Diskurs Dermatologie 2022 (3), 16–17
15 D. W. Paquette, D. M. Simpson, P. Friden, V. Braman, R. C. Williams, Safety and clinical effects of topical histatin gels in humans with experimental gingivitis, J Clin Periodontol. 29 (12), 1051–1058 (2002)
16 P. Del Vigna de Almeida et al., Saliva composition and functions: a comprehensive review, J contemp dent pract 9 (3), 72–80 (2008)
17 S. Bouatra et al, The Human Urine Metabolome, PLOS ONE, 4. September 2013; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0073076
18 www.pharmazeutische-zeitung.de/schutzschild-in-der-nase-141830
19 H. Lautenschläger, Intimpflege – sensibel & schonend, medical Beauty Forum 2017 (6), 38–41

Dr. Hans Lautenschläger
Der promovierte Chemiker ist seit 1998 geschäftsführender Gesellschafter der Koko Kosmetikvertrieb GmbH & Co. KG in Leichlingen und spezialisiert auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb physiologischer Hautpflegemittel. www.dermaviduals.de