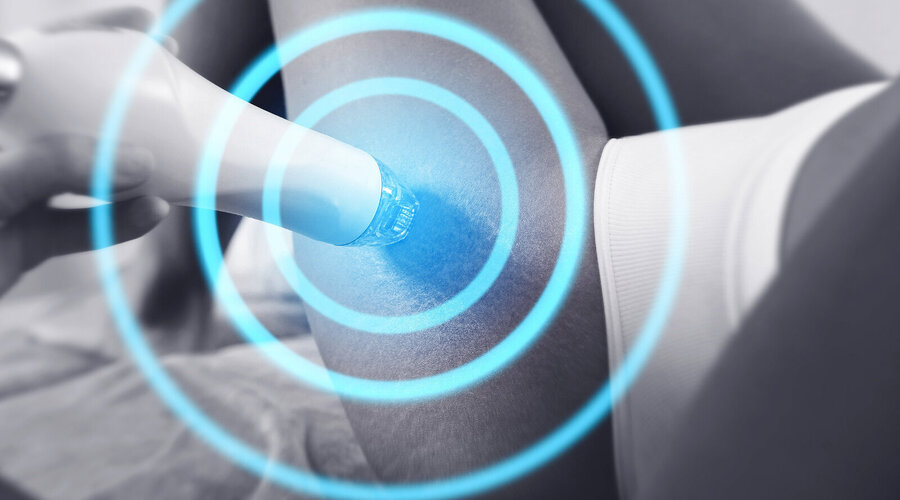Die Bandbreite der Behandlungsmethoden bei Hyperpigmentierungen ist groß. In der Praxis stellt sich regelmäßig die Frage, welche dieser Verfahren für Kosmetikerinnen und Heilpraktikerinnen rechtlich zulässig sind und ab wann ein Arztvorbehalt greift. Maßgeblich ist hier vor allem die NiSV, ergänzt durch das Heilpraktikergesetz und die allgemeinen Regeln des ärztlichen Berufsrechts.
1. NiSV
Die Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSV) regelt den gewerblichen Einsatz nichtionisierender Strahlung zu nichtmedizinischen, insbesondere kosmetischen Zwecken. Sie kommt bei Laser- und IPL-Geräten, aber auch bei Hochfrequenz-, Ultraschall- und Kälte-/Wärmeverfahren zum Einsatz. Wird eine Hyperpigmentierung also beispielsweise mit einem Laser behandelt, ohne dass eine medizinische Indikation vorliegt, unterfällt die Anwendung dem Regelungsbereich der NiSV.
Für solche kosmetischen Eingriffe sind umfangreiche Anforderungen zu erfüllen: So müssen die Behandler über einen spezifischen Sachkundenachweis verfügen, eine ausführliche Anamnese und Aufklärung dokumentieren, die Geräte regelmäßig prüfen lassen und die Tätigkeit beim Gesundheitsamt anzeigen.
Noch restriktiver ist § 5 Abs. 2 NiSV, der bestimmte Anwendungen ausschließlich Ärzten vorbehält, auch dann, wenn sie nicht zu Heilzwecken erfolgen. Darunter fallen insbesondere Eingriffe, bei denen Hautgewebe gezielt zerstört oder abgetragen wird. Dies betrifft die Mehrzahl der effektiven Verfahren zur Behandlung von Hyperpigmentierungen mittels Laser oder IPL. Hierbei handelt es sich regelmäßig um eine gezielte photothermische oder photomechanische Zerstörung von Pigmentstrukturen in der Dermis oder Epidermis, ein Vorgang, der nach der gesetzgeberischen Wertung erhebliche Risiken birgt und daher zwingend ärztliche Kompetenz erfordert. Kosmetikerinnen und auch Heilpraktikerinnen ist die Durchführung solcher Maßnahmen daher verboten, unabhängig davon, ob eine medizinische Diagnose gestellt wird oder nicht.
2. Heilpraktikergesetz
Auch das Heilpraktikergesetz gilt es zu beachten. Es erlaubt Nichtärztinnen die Ausübung der Heilkunde, sofern sie über eine Heilpraktikererlaubnis verfügen. Behandlungen von Hyperpigmentierungen, die auf einer zugrunde liegenden Hauterkrankung beruhen, etwa hormonell bedingte Melasmen oder postinflammatorische Pigmentierungen nach chronischen Dermatosen, können daher grundsätzlich auch von Heilpraktikerinnen durchgeführt werden, sofern keine methodische Einschränkung besteht. Dies betrifft etwa die Anwendung bestimmter Cremes, äußerlicher Therapeutika oder chemischer Peelings. Eingriffe mit Laser oder IPL bleiben jedoch auch Heilpraktikerinnen verwehrt, da sie ungeachtet der Heilkundeausübung unter den zwingenden Arztvorbehalt der NiSV fallen.
3. Medizinisch oder kosmetisch?
Entscheidend ist also die genaue Einordnung der geplanten Maßnahme: Geht es um eine medizinisch in-dizierte Therapie, etwa bei starker psychischer Belastung oder pathologischen Ursachen, ist die Behandlung ärztlich oder heilpraktisch zulässig, abhängig von der Methode. Erfolgt sie dagegen rein kosmetisch, muss zusätzlich geprüft werden, ob die eingesetzte Technologie unter die NiSV fällt und gegebenenfalls ärztlichen Vorbehalten unterliegt.
Nichtärztliches Personal darf kosmetische Verfahren zur Verbesserung des Hautbilds zwar grundsätzlich anbieten, ist bei apparativen Verfahren jedoch durch die NiSV stark eingeschränkt. Bei Verstößen drohen Bußgelder und berufsrechtliche Sanktionen.
Insbesondere in Instituten, die mit apparativen Verfahren zur Hautbildverbesserung werben, ist daher eine sorgfältige rechtliche Prüfung der eingesetzten Technologie und der Qualifikation des Personals unabdingbar. Dabei spielt auch die konkrete Bewerbung der Behandlung eine zentrale Rolle: Wird etwa mit medizinischen Begriffen oder Heilerwartungen geworben, kann dies eine heilkundliche Einordnung nach sich ziehen. Gleichzeitig orientieren sich Aufsichtsbehörden bei einer Kon-trolle nicht nur an der Werbung, sondern prüfen regelmäßig auch die technischen Eigenschaften des eingesetzten Geräts, vor allem anhand der Bedienungsanleitung und der Herstellerangaben.

Dr. Florian Meyer
Der Rechtsanwalt berät seit 2006 Kosmetikunternehmen zu verschiedenen Rechtsthemen, u.a. zur Vertragsgestaltung und zu Haftungsfragen, zum Wettbewerbsrecht, zum Heilmittelwerberecht sowie zum Kosmetik- und Medizinprodukterecht.