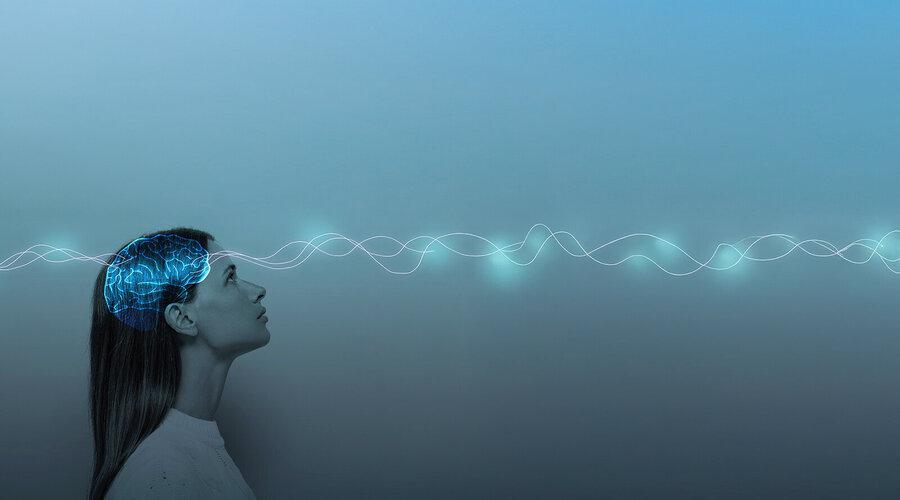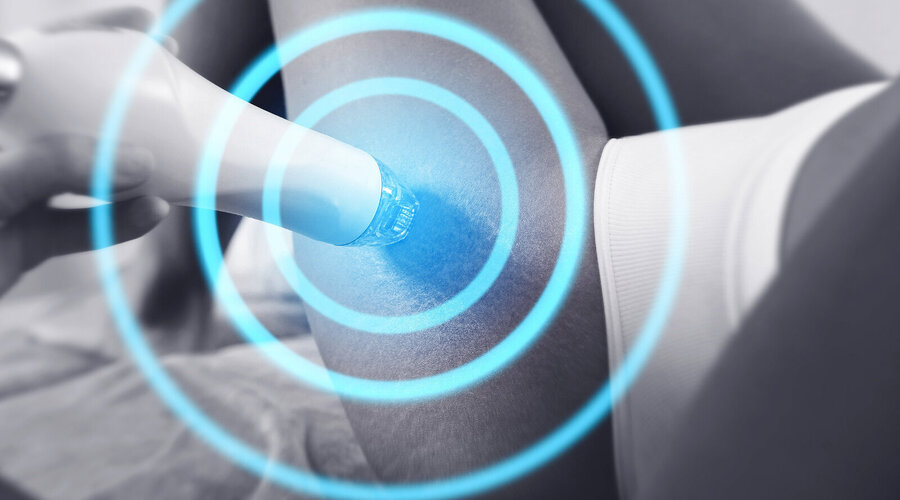Behandlungen bei Rötungen, Teleangiektasien und einer allgemeinen Gefäßlabilität sind im Bereich der ästhetischen Dienstleistungen sehr gefragt. Doch wie bei vielen anderen ästhetischen Behandlungsmethoden stellt sich die Frage: Welche Eingriffe sind noch kosmetisch zulässig und welche unterfallen dem Arztvorbehalt oder dem Heilpraktikergesetz?
Kosmetikerinnen dürfen nur solche Behandlungen anbieten, die nicht als Ausübung der Heilkunde im Sinne des § 1 HeilprG gelten. Die Heilkunde umfasst jede berufs- oder gewerbsmäßige Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden beim Menschen. Sobald eine Behandlung objektiv auf eine krankhafte Gefäßveränderung (zum Beispiel Rosacea, Couperose) abzielt, handelt es sich zumindest nach Auffassung vieler Behörden grundsätzlich um Heilkunde. Darüber hinaus regelt die Verordnung zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NiSV) die Zulässigkeit bestimmter apparativer Behandlungen. Besonders relevant ist § 5 Abs. 2 NiSV. Die Vorschrift enthält einen Arztvorbehalt für Maßnahmen, bei denen Gewebe thermisch oder mechanisch gezielt zerstört oder abgetragen wird, was bei vielen Gefäßbehandlungen mittels IPL oder Laser der Fall ist. Der Einsatz solcher Geräte darf daher ausschließlich durch Ärzte erfolgen.
Zulässige Behandlungen
Kosmetikerinnen dürfen grundsätzlich folgende nicht medizinischen Maßnahmen bei Rötungen oder empfindlicher Haut durchführen:
- Manuelle Anwendungen wie sanfte Reinigungen, beruhigende Masken oder Massagen mit gefäßstabilisierenden Wirkstoffen
- Kosmetische IPL- und Laseranwendungen sowie Plasma- und Ultraschallbehandlungen, sofern sie auf eine oberflächliche Hautverbesserung abzielen
- Peelings mit niedrig konzentrierten Fruchtsäuren, die nicht in tiefere Hautschichten eindringen
Dabei sollte beachtet werden: Die Anwendungen dürfen nicht den Anschein erwecken, dass eine krankhafte Veränderung der Haut behandelt wird. Auch eine Bewerbung mit Begriffen wie „medizinisch“, „Gefäßbehandlung“ oder „Rosacea-Therapie“ ist zu vermeiden. Der Begriff „Hautrötung“ hingegen weist noch nicht zwingend auf eine heilkundliche Behandlung hin.
Ärztliche Behandlungen
Sobald die Diagnose einer Krankheit im Raum steht, etwa Couperose, Rosacea oder chronisch dilatierte Kapillaren, ist die Behandlung dem Arzt vorbehalten. Typische medizinische Verfahren sind:
- Laserbehandlungen mit dem Ziel der Gefäßverödung
- IPL-Therapie mit medizinischer Indikation, etwa zur Behandlung entzündlicher Veränderungen
- Venenverödung (Sklerosierung) bei ausgeprägten Teleangiektasien, insbesondere an den Beinen
Diese Methoden sind nicht nur wegen der verwendeten Technik, sondern auch aufgrund des Eingriffs in das Gefäßsystem ausschließlich Ärzten vorbehalten. Heilpraktiker dürfen zwar Heilkunde ausüben, müssen sich aber ebenfalls an die Vorgaben der NiSV halten. Auch ihnen ist der Einsatz von Lasern oder IPL zur gezielten kosmetischen Behandlung von Gefäßveränderungen verboten.
Rechtsprechung und Behördenpraxis
Die Gerichte orientieren sich bei der Abgrenzung zunehmend an den funktionalen Kriterien. Führt die eingesetzte Technik zu einer Gewebeveränderung? Wie hoch ist das Risiko der Behandlung? In solchen Fällen wird regelmäßig von einer heilkundlichen Tätigkeit ausgegangen, es entscheidet jedoch stets der Einzelfall.
Fazit
Kosmetikerinnen dürfen Rötungen oder Gefäßlabilität nur dann behandeln, wenn die Maßnahme nicht auf eine therapeutische Beseitigung krankhafter Befunde gerichtet ist. Der Einsatz apparativer Technologien wie Laser, IPL, Radiofrequenz ist durch die NiSV streng reguliert und in vielen Fällen ausschließlich Ärzten vorbehalten.
Heilpraktiker verfügen über eine weitergehende Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, sind jedoch ebenso durch die NiSV in apparativen Verfahren zu kosmetischen eingeschränkt. Anbieter ästhetischer Leistungen rund um Gefäße und Hautrötungen sind daher gut beraten, ihre Verfahren rechtlich überprüfen zu lassen, um Anwendungsverbote, Bußgelder oder strafrechtliche Folgen zu vermeiden.

Dr. Florian Meyer
Der Rechtsanwalt berät seit 2006 Kosmetikunternehmen zu verschiedenen Rechtsthemen, unter anderem zur Vertragsgestaltung und zu Haftungsfragen, zum Wettbewerbsrecht, zum Heilmittelwerberecht sowie zum Kosmetik- und Medizinprodukterecht.