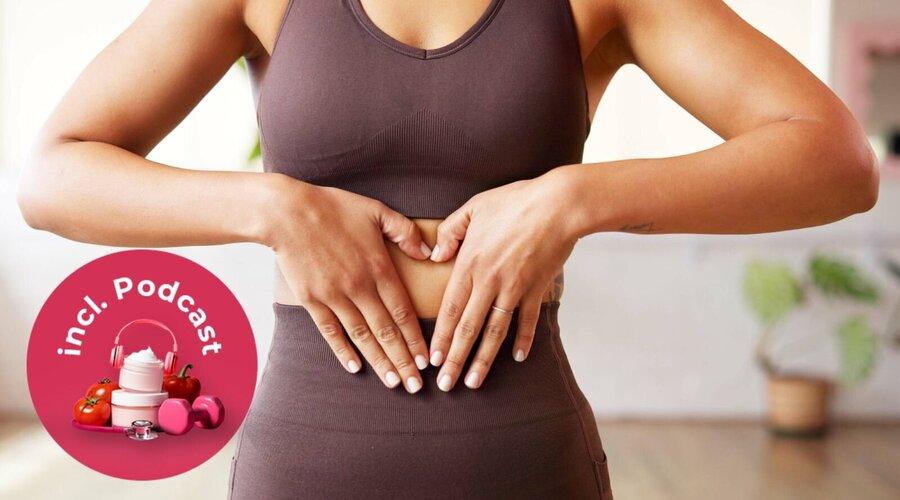Intervallfasten ist eine Methode, bei der die Essenszeiten zeitlich begrenzt werden. Viele Menschen nutzen diese Form, um ihr Gewicht zu regulieren, den Stoffwechsel zu beeinflussen oder ihr Wohlbefinden zu fördern. Verschiedene Ansätze und deren Wirkungen werden untersucht und sind abhängig von den individuellen Lebensumständen.
Intervallfasten – auch intermittierendes Fasten genannt – beschreibt eine Ernährungsform, bei der sich Essens- und Fastenphasen rhythmisch abwechseln. Im Fokus steht nicht primär, was gegessen wird, sondern wann. Während der Fastenphasen werden dem Körper keine Kalorien zugeführt. Wasser, ungesüßter Tee oder schwarzer Kaffee sind jedoch erlaubt. Die Fastenperioden zwingen den Organismus dazu, Energie vermehrt aus gespeicherten Fettreserven zu beziehen, was den Abbau von Körperfett fördern kann. Darüber hinaus werden verschiedene hormonelle und zelluläre Prozesse aktiviert, die ebenfalls zu gesundheitlichen Vorteilen beitragen können.
16:8-Methode – der etablierte Standard
Bei dieser Methode wird täglich 16 Stunden gefastet, gefolgt von einem 8-stündigen Essensfenster – zum Beispiel von 12 bis 20 Uhr. In der Praxis bedeutet das für viele: Das Frühstück entfällt, die erste Mahlzeit erfolgt mittags.
Vorteile:
- Alltagstauglich und gut kombinierbar mit beruflichen Routinen.
- Keine aufwendige Kalorienzählung notwendig.
- Wissenschaftlich belegt positive Effekte auf Insulinsensitivität und Körperfettanteil.
Herausforderung:
- Anfangs kann es zu Hungergefühlen oder Konzentrationsproblemen kommen.
- Besonders in den ersten Tagen kann der Verzicht auf das Frühstück zu Energieeinbrüchen, Gereiztheit oder Schlafstörungen führen, bis sich der Stoffwechsel auf den neuen Rhythmus eingestellt hat.
Tipp:
- Starten Sie mit 12:12 und tasten Sie sich von Woche zu Woche an 16:8 heran – das erleichtert den Einstieg.
5:2-Diät – Fasten in der Wochenstruktur
Hierbei wird an fünf Tagen pro Woche regulär gegessen, an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen jedoch die Kalorienzufuhr stark eingeschränkt (Frauen circa 500 kcal, Männer circa 600 kcal).
Vorteile:
- Flexible Gestaltung der Fastentage.
- Kein vollständiger Verzicht – dadurch oft hohe Akzeptanz.
- Nachgewiesene Wirkung auf Gewicht, Blutdruck und Blutzucker.
Herausforderung:
- Gefahr von Überkompensation an den normalen Tagen.
- An Fastentagen sind Energie und Leistungsfähigkeit eingeschränkt.
Alternate-Day-Fasting (ADF) – Fasten im Wechsel
Beim ADF wechseln sich Fasten und Essen im täglichen Rhythmus ab. Fastentage können komplett ohne Nahrung oder mit sehr geringer Kalorienaufnahme gestaltet werden. ADF ist in Deutschland bislang wenig bekannt und wird vor allem in der internationalen Forschung – insbesondere in den USA – untersucht. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich gut belegt, allerdings ist die Methode aufgrund der Strenge nicht für jede Lebenssituation geeignet.
Vorteile:
- In Studien deutlicher Gewichtsverlust möglich (bis zu sechs kg in acht Wochen).
- Verbesserungen bei Entzündungswerten und Blutfettprofilen dokumentiert.
Herausforderung:
- Der ständige Rhythmuswechsel kann psychisch und sozial belastend sein.
- Langfristige Umsetzung im Alltag oft schwierig.
Eat-Stop-Eat – Fasten im 24-Stunden-Takt
Diese Form sieht ein- bis zweimal wöchentlich eine vollständige Fastenphase von 24 Stunden vor – zum Beispiel von 18 Uhr abends bis 18 Uhr am nächsten Tag. Eat-Stop-Eat stammt ursprünglich aus dem angloamerikanischen Raum und ist bei uns noch wenig verbreitet. Die wissenschaftliche Datenlage ist bislang begrenzt, die Methode gilt aber als potenziell wirksam – insbesondere wenn sie gut in den persönlichen Alltag integriert wird.
Vorteile:
- Aktivierung regenerativer Zellprozesse (zum Beispiel Autophagie).
- Klare Struktur und bewusste Auseinandersetzung mit Essverhalten.
Herausforderung:
- Ein ganzer Tag ohne Nahrungszufuhr erfordert viel Disziplin.
- Kann anfangs zu körperlicher Schwäche führen.
- Kaum umsetzbar im Alltag.
Struktur statt Verzicht
Intervallfasten bietet eine alltagstaugliche Möglichkeit, das Essverhalten zu strukturieren und dabei Körpergewicht sowie Stoffwechsel positiv zu beeinflussen. Die wissenschaftliche Basis ist vielversprechend, auch wenn langfristige Daten teils noch ausstehen.
Wichtig ist, die passende Methode individuell auszuwählen und auf eine ausgewogene Ernährung während der Essensphasen zu achten. Denn auch beim Fasten gilt: Nicht der kurzfristige Effekt zählt, sondern die nachhaltige Umsetzbarkeit im eigenen Lebensstil.

Holger Westenbaum
Der Autor ist CEO der PS. food & lifestyle GmbH mit Sitz in München und seit über 30 Jahren als Ernährungs- und Gesundheitsexperte bekannt. In seinem Fachgebiet war er bereits Autor zahlreicher Publikationen. www.psfoodandlifestyle.de