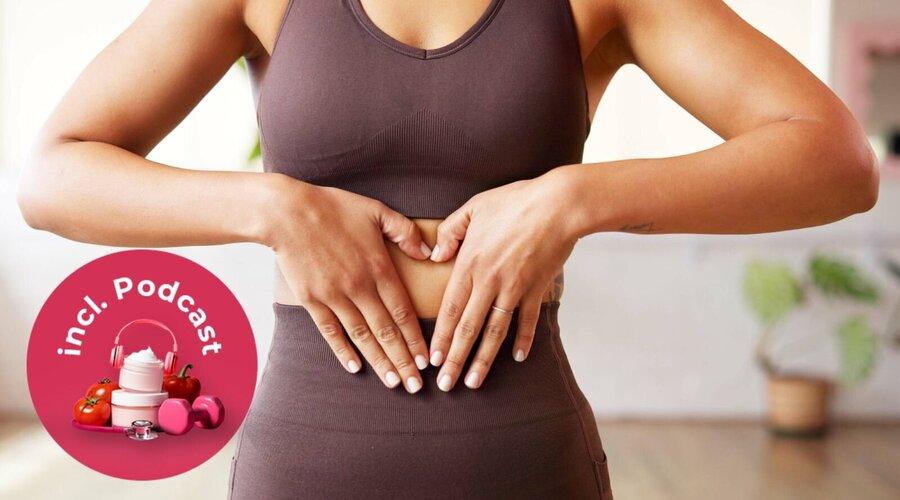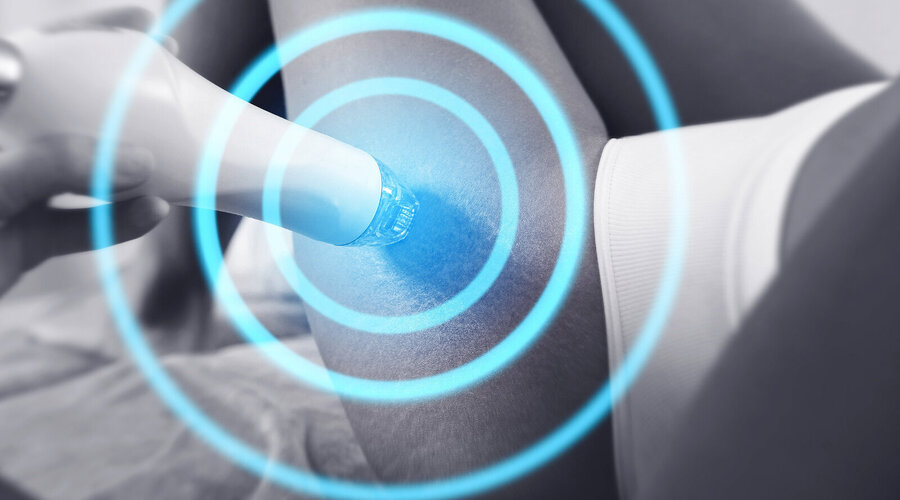Gendermedizin wird häufig als Frauengedöns betrachtet. Hier wird deutlich, dass die Wahrnehmung von Frauen und deren Erkrankungen keine Priorität besitzt und das Wort „Gendermedizin“ missverstanden wird. Deshalb hat sich mittlerweile auch der Begriff „Geschlechtersensible oder Geschlechterspezifische Medizin“ etabliert. Darunter versteht man die sozialen und biologischen Einflussfaktoren auf die Gesundheit und Krankheit, die sich nach Geschlecht unterscheiden.
Diese sozialen und biologischen Einflussfaktoren können sich zum Beispiel in der Häufigkeit und Ursachen von Erkrankungen zeigen oder in der Ausprägung von Symptomen und Krankheitsverlauf. Auch Therapien und die Wirksamkeit von Arzneimitteln können sich geschlechterspezifisch unterscheiden. Die Ursachen können biologischer Natur sein – also im Körperbau, in den Genen oder den Hormonen liegen. Aber auch „Gender“ – also das soziale Geschlecht– hat Einfluss auf Gesundheit und Krankheit und ist eng mit gesundheitlicher Entwicklung verbunden.
Menschen werden in Gesellschaftsformen und Familien hineingeboren, sodass sich Geschlechterstereotypen und bestimmte Verhaltens- und Denkweisen geschlechterspezifisch ausprägen. Hierzu gehören zum Beispiel unterschiedliche Kommunikationsverhalten, Lebensstil, Körperwahrnehmung, Umgang mit Krankheit und der soziale Umgang miteinander.
So entstand die geschlechtersensible Medizin
Die Wiege der Geschlechtersensiblen Medizin ist die Forschung von Wissenschaftlerinnen, die in den 1980er-Jahren erkannt haben, dass die Gefahr für Frauen, einen Herzinfarkt nicht zu überleben, deutlich höher ist als für Männer.
Mittlerweile sind viele Krankheitsbilder und deren Geschlechterunterschiede erforscht, aber es bleibt noch viel zu tun. Es ist leider immer noch kein Standard, die wissenschaftlichen Daten getrennt nach Geschlecht auszuwerten, aber nur so ist es möglich, bestehende Unterschiede überhaupt zu entdecken.
Das zweite große Thema ist die Lehre. Im Medizinstudium und in der Pflegeausbildung sind die bereits erforschten Unterschiede weder Inhalt des Curriculums noch prüfungsrelevant. Dies führt dazu, dass auch in der heutigen Zeit ausgebildete Fachkräfte (zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte sowie Notfallpersonal) über dieses Wissen nicht standardmäßig verfügen. Jede Fachkraft muss sich diese Kenntnisse freiwillig selbst aneignen oder Fortbildungsangebote wahrnehmen.
Unterschiede bei Frauen und Männern
Ein Grund für die biologisch begründbare spezifische Wirksamkeit von Medikamenten ist die unterschiedliche proportionale Zusammensetzung von Muskel- und Fettanteil zwischen Frauen und Männern.
Das hat zur Folge, dass Medikamente anders wirken und verstoffwechselt werden. Frauen haben ein trägeres Verdauungssystem als Männer, sie haben kleinere Organe, weniger Blutvolumen, weniger Muskel- und mehr Fettanteil, (was die Verteilung und den Serumspiegel von Medikamenten beeinflussen kann) und weniger Leistungsvermögen der Niere und Leber (was den Abbau von Medikamenten verzögern kann).
Alles zusammengenommen, ist für Frauen die Chance, bei gleicher Dosis einen höheren Medikamentenspiegel und mehr Nebenwirkungen zu zeigen als Männer, erhöht. Aber auch unsere unterschiedlichen Hormone können die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen. Dies wird jedoch in Studien meist nicht betrachtet, sodass auch keine geschlechtergetrennten Empfehlungen im Beipackzettel stehen.
Biologische und soziale Faktoren
Frauen haben in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern eine höhere Lebenserwartung als Männer. Warum ist das so?
Hier spielen biologische und soziale Faktoren eine Rolle. Frauen verfügen über ein besser ausgestattetes Immunsystem, das im Rahmen der Evolution das Überleben der Nachkommen sichern sollte. Eine Schwangerschaft, Geburt und Stillen sind risikobehaftet, was Infektionen betrifft, und somit schafft ein „bissigeres“ Immunsystem einen Ausgleich. Während der Corona-Pandemie konnte man sehen, dass Männer ein wesentlich höheres Risiko hatten, an COVID-19 zu versterben. An einem Long-COVID-Syndrom jedoch erkrankten Frauen dreimal häufiger als Männer und auch an Autoimmunerkrankungen leiden Frauen häufiger. Diese Tatsachen sind als „Kehrseite der Medaille“ zu verstehen, da ein aggressiveres Immunsystem auch anfälliger dafür ist, Autoimmunreaktionen zu entwickeln.
Aber den größten Anteil der höheren Lebenserwartung von Frauen hat die Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt einen gesünderen Lebensstil pflegen und besser auf ihre Gesundheit achten, zum Beispiel mehr an den Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen und sich früher Hilfe holen. Die gute Nachricht für die Männer ist, dass es für sie noch viele Jahre „zu holen“ gibt, wenn sie ihren Lebensstil (Ernährung, Rauch- und Trinkverhalten) ändern und sich häufiger untersuchen lassen. Lebensstilfaktoren sind nicht angeboren – sie werden angeeignet und sie können verändert werden.
Es gibt noch viel zu berichten – etwa über Unterschiede im Kommunikationsstil, der nicht nur Patientinnen und Patienten betrifft, sondern auch Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal. Aber auch einzelne Erkrankungen und deren Geschlechterunterschiede wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der Lunge, Diabetes oder Depression.

Dr. Hildegard Seidl
Die Autorin ist ausgebildete Intensivpflegekraft, Volkswirtin, Gesundheitswissenschaftlerin und promovierte Humanbiologin. Sie arbeitet in der München
Klinik und leitet verschiedene Projekte zur Sicherstellung einer geschlechtersensiblen Versorgung der Patientinnen und Patienten.