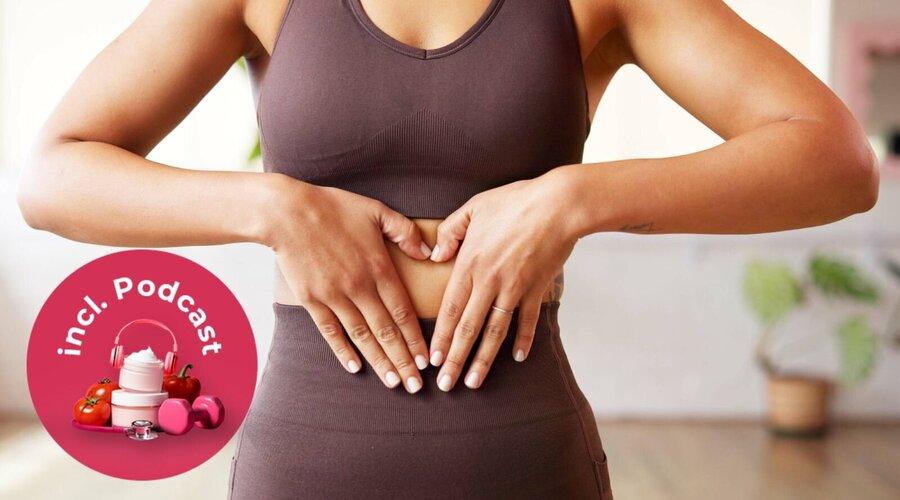Es gibt Stoffe, bei denen immer wieder Verwirrung hinsichtlich ihrer Bezeichnung und Anwendung im medizinischen oder kosmetischen Kontext besteht. In dieser Serie stellt die promovierte Chemikerin Dr. Ghita Lanzendörfer-Yu die prominentesten Beispiele vor und klärt auf.
Kamillentee ist ein Hausmittel, das wohl jede kennt. Manche lieben es, andere fühlen sich an Zeiten von Jugendherbergen zurückerinnert. Dabei ist die Kamille eine Pflanze mit vielen guten Eigenschaften: Der Tee ist nur eine Anwendungsform von vielen. Denn Kamille hat ein enorm breites Anwendungsspektrum.1
Über die echte Kamille sind mehr als reichhaltige Informationen vorhanden, deswegen möchte ich hier den Blick erweitern und die Römische Kamille und die Chinesische Tee-Chrysantheme mit in die Betrachtung aufnehmen. Sie werden ebenfalls gern als Tee gereicht.
Echte Kamille – die wichtigsten Infos
Unter dem generischen Namen „Kamille“ firmieren verschiedenartige Pflanzen mit unterschiedlichen botanischen Namen, die auch in der Volldeklaration von Kosmetika in ihrer lateinischen Form angeführt werden.
Alle Kamillen gehören dabei zu der Familie der Astern (Korbblütler, wie also auch Astern, Sonnenblume oder Löwenzahn), aber zu unterschiedlichen Gattungen.
Da ist zunächst die echte Kamille, ein buschiger, eher kleiner Strauch mit 15 bis 50 Zentimeter Wuchshöhe. Die echte Kamille wird im Arzneibuch2 als Matricaria recutita L. geführt. Obwohl sie zur Gattung Matricaria gehört wird, sie auch als Matricaria chamomilla, oder Chamomilla recutita benannt. Sie besitzt verschiedene pharmakologische Wirkungen: entzündungshemmend, krampflösend, antibakteriell, entblähend, mild schmerz- und juckreizstillend sowie wundheilungsfördernd. Weiterhin hat sie antimykotische, antiulzerative, antivirale und beruhigende Effekte. Die echte Kamille ist sozusagen ein Tausendsassa unter den medizinisch wirksamen Pflanzen.3
Matricaria - du bist nicht allein
Als Kamille wird aber auch die Römische Kamille bezeichnet und auch hier gibt es Namensvarianten; Anthemis nobilis oder Chamaemelum nobilis. Sie kann leicht mit der echten Kamille verwechselt werden. Sie gehört zur Gattung Chamaemelum.
Unter der dritten Gattung Chrysanthemen findet sich die Chinesische Tee-Chrysantheme Chrysanthemum morilifolium, die der Kamille ebenfalls ähnlich sieht mit weißen Blütenblättern und gelber Mitte.
Wichtige Inhaltsstoffe der ätherischen Öle
Die ätherischen Öle der verschiedenen Kamillenarten werden üblicherweise durch Wasserdampfdestillation der Blüten erhalten. Bei der echten Kamille machen diese 0,3 bis 1,5 Prozent der Pflanzenmasse aus. Sie gelten in der Pharmakologie als die wirksamen Bestandteile, aber nur die? (Das schauen wir uns später noch genauer an.)
Trotz ähnlichen Aussehens und ähnlicher Wirkspektren sind diese „Cousinen“ sehr unterschiedlich, was die Zusammensetzung der ätherischen Öle angeht (siehe Tabelle).
Die Zusammensetzung der ätherischen Öle schwankt erheblich mit dem Erntezeitpunkt, des Genotypes (Zuchtform), klimatischen Bedingungen und der Anbauregion.
Während dem ätherischen Öl der echten Kamille die pharmakologische Wirkung zugeschrieben wird und direkt mit Bisabolol und Chamazulen zu korrelieren scheint, ist es bei der Römischen Kamille und der Tee-Chrysantheme anders. Ihre ätherischen Öle werden überwiegend in der Aromatherapie und Parfümindustrie genutzt. Den Angelatestern in der Römischen Kamille werden starke antimikrobielle Eigenschaften zu gewiesen. Aber auch ihre Wirkung als Psychostimulanzien wird untersucht.7 Bei der Tee-Chrysantheme wird ebenfalls eine gute antimikrobielle und antioxidative Wirkung beobachtet, diese ist aber auf völlig andere Substanzen zurück zu führen als bei der Römischen Kamille.8 Zusätzlich wird die echte Kamille bzw ihre Extrakte wie Bisabolol oder Azulen in der Hautpflege verwendet.
Vergleich der therapeutischen Wirksamkeit
Matricaria recutita ist am umfassendsten dokumentiert, besonders in der medizinischen Anwendung (innerlich wie äußerlich). Chamaemelum nobile hat ähnliche, aber etwas mildere Wirkungen, dafür mit stärkerem Fokus auf beruhigende und spasmolytische Effekte, bedingt durch die Angelatester. Chrysanthemum morifolium ist weniger breit pharmakologisch erforscht, zeigt aber relevante entzündungshemmende und antibakterielle Effekte (zum Beispiel gegen Hauterreger und bei Atemwegserkrankungen) sowie antioxidative und immunmodulierende Wirkungen in der TCM. Dort wird sie als süß und bitter, sowie als leicht kühlend beschreiben und gilt als fiebersenkend.
Kamillen – mehr als ätherische Öle
Bei der Betrachtung allein der ätherischen Öle lassen sich nicht all die guten Eigenschaften dieser Blüten/Pflanzen erklären. Denn üblicherweise nutzen wir nicht nur ein Extrakt, sondern zum Beispiel als Tee die ganze Blüte. Und da kommen in der Regel noch weitere wertvolle Stoffe vor wie Flavonoide, die für die Farbe verantwortlich sind, aber auch antioxidativ wirken, oder Polysaccharide, die wir mit ihren erstaunlichen Wirkspektren schon kennengelernt haben. Darüber hinaus kommen Cumarine vor und organische Säuren. Diese sind natürlich für die Echte Kamille am genauesten untersucht.9
Ja, und dann sind da auch noch die Pflanzen selbst, die ebenfalls gute Wirkungen auf ihre Umge-bung entfalten können. Für Gärtnerinnen ist die Echte Kamille auch ein Heilmittel im Garten, da sie den Boden verbessert und das Wachstum benachbarter Pflanzen fördert.10 Für Tees wird sie überwiegend in Thüringen angebaut. Die Römische Kamille wird auch als Rasenersat11 genutzt und die Tee-Chrysantheme als Tee, dem in der TCM günstige Wirkungen auf die Entgiftung des Körpers und die Förderung der Langlebigkeit zugeschrieben werden.12
Nun denn - das spricht doch alles für einen leckeren Tee aus welcher Kamille auch immer.
Literatur:
1 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2995283/
2 www.pharmazeutische-zeitung.de/titel-05-2003/
3 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/
10.1002/ffj.3397
4 https://www.mdpi.com/2304-8158/9/10/1460
5 www.liebertpub.com/doi/abs/10.2310/ 6620.2010.09072
6 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9032859/
7 https://samen.de/blog/kamille-als-begleitpflanze-positive-effekte-auf-andere-kulturen.html
8 https://link.springer.com/chapter/
10.1007/978-981-19-6080-2_8
9 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9032859/
10 https://samen.de/blog/kamille-als-begleitpflanze-positive-effekte-auf-andere-kulturen.html
11 www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/ziergaerten/roemische-kamille-als-rasenersatz-5986
12 https://link.springer.com/chapter/
10.1007/978-981-19-6080-2_8

Dr. Ghita Lanzendörfer-Yu
Die Autorin ist unabhängige
Beraterin und war als Chemikerin
in der kosmetischen Produktentwicklung tätig.
www.dejayu.de
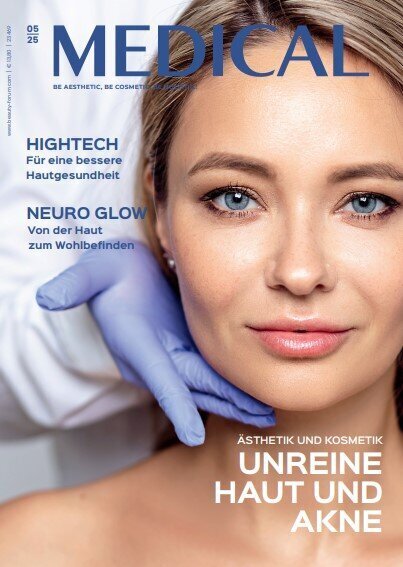
Dieser Artikel stammt aus dem Fachmagazin MEDICAL
Lust in Ruhe durchzublättern?
Dann hol dir jetzt die Zeitschrift nach Hause!