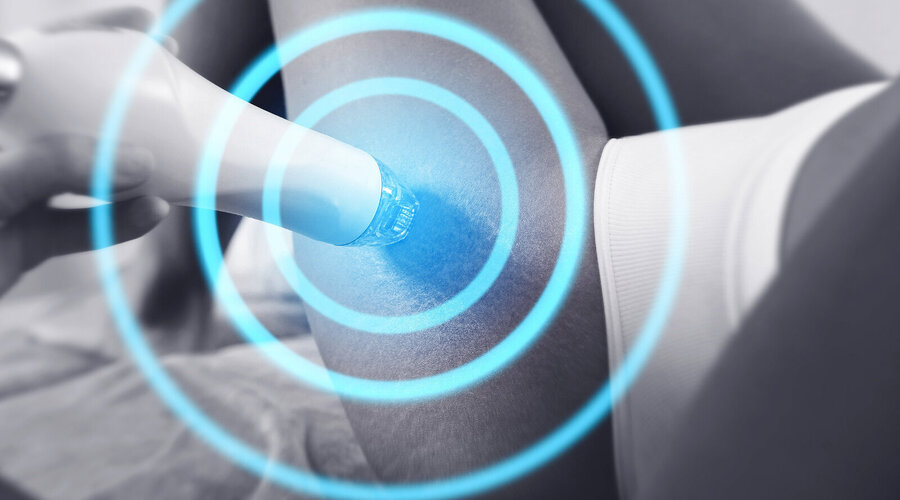Medizinische Leitlinien sind systematisch entwickelte, wissenschaftlich begründete und praxisorientierte Entscheidungshilfen. Sie sollen Ärzten Empfehlungen geben, wie eine Erkrankung festgestellt und behandelt werden sollte. Auch Kosmetikerinnen können eine Menge von ihnen für ihre Arbeit ableiten. In Teil 10 unserer Leitlinien-Serie stellt Ihnen die angehende Ärztin, Kosmetikerin und Beauty Managerin Sarah White die wichtigsten Fakten aus der Leitlinie Rosacea vor.
1. Definition (Beschreibung, Aussehen)
Rosacea, früher auch als Gesichtsrose oder Kupferfinne bezeichnet, ist eine chronisch-entzündliche, nicht infektiöse Hauterkrankung des Gesichts. Sie betrifft insbesondere hellhäutige Erwachsene im mittleren Alter und äußert sich durch anhaltende Rötungen (Erytheme), erweiterte Äderchen (Teleangiektasien) und entzündliche Papeln und Pusteln.
In fortgeschrittenen Stadien kann es auch zu einer chronisch-entzündlichen, nicht infektiösen Hauterkrankung des Gesichts sowie Hautverdickung, meist im Bereich der Nase, kommen. Typisch ist ein schubweiser Verlauf – die Beschwerden treten plötzlich auf, können sich durch äußere Reize verschlimmern und zwischenzeitlich wieder abklingen. Häufig ist die Haut gereizt, brennt und es besteht ein unangenehmes Hitzegefühl („Flush“).
2. Epidemiologie (Prävalenz, Geschlecht, Alter)
Die Prävalenz der Rosacea variiert von Studie zu Studie und schwankt in Mitteleuropa zwischen zwei und zehn Prozent der Bevölkerung, wobei die Dunkelziffer vermutlich höher liegt.
Besonders häufig werden Personen mit hellem Hauttyp (Fitzpatrick I und II) diagnostiziert – interessanterweise jedoch nicht wegen einer niedrigeren Prävalenz der Hauttypen IV-VI, sondern aufgrund einer scheinbar hohen diagnostischen Lücke und einem uneindeutigen klinischen Bild.
Frauen sind insgesamt häufiger betroffen als Männer, allerdings zeigen Männer tendenziell schwerere und fortgeschrittenere Verläufe, insbesondere mit Rhinophymbildung (Knollennase). Die Erkrankung beginnt meist zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Jugendliche und Kinder erkranken selten.
3. Ätiologie (Disposition, Trigger)
Eine genaue Ursache der Rosacea ist bislang nicht vollständig geklärt. Vielmehr wird von einem multifaktoriellen Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, gestörter Immunabwehr, entzündlicher Gefäßreaktion und neurovasku-lärer Fehlsteuerung ausgegangen. Wichtige Triggerfaktoren sind UV-Strahlung, starke Temperaturunterschiede, Wind, heiße Getränke, scharfe Gewürze, Alkohol, emotionaler Stress, körperliche Anstrengung, bestimmte Medikamente und hormonelle Schwankungen.
Auch Kosmetika mit reizenden Inhaltsstoffen wie Alkohol, Formaldehyd oder Parfüm können die Beschwerden verschlimmern. Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine Dysregulation des Hautmikrobioms, mit übermäßiger Besiedlung mit Demodex folliculorum (Haarbalgmilbe), sowie des Darmmikrobioms, beim SIBO-Syndrom, eine wichtige Rolle in der Pathogenese spielen könnten.
4. Symptome und Verlaufsformen
Rosacea ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl klinischer Erscheinungsformen. Aufgrund der chronischen Natur verläuft Rosacea oft über Jahre hinweg mit wechselnder Intensität, was zu erheblicher psychischer Belastung führen kann. Typische Beschwerden sind:
- Anhaltende Gesichtsrötung (Erythem), besonders auf Nase und Wangen
Erweiterte Kapillaren (Teleangiektasien) - Papeln und Pusteln, die an Akne erinnern können (allerdings ohne Komedonen)
- Brennendes oder stechendes Gefühl auf der Haut
- Trockenheit oder Schuppung
- Phyme: Verdickungen und Knollenbildung, vor allem an der Nase (Rhinophyme)
- Augenbeteiligung mit Lidrandentzündung, Trockenheit, Fremdkörpergefühl (bei etwa 50 Prozent)
Die Symptome treten meist schubweise auf. Bis 2017 unterteilte man die Rosacea nach den Subtypen erythematös-teleangiektatisch, papulopustulös und phymatös. Diese Subtyp-basierte Einteilung wurde 2017 ersetzt durch eine phänotypische Klassifikation, um der klinischen Vielfalt und Überlappung der Symptome besser gerecht zu werden. Die Diagnose erfolgt demnach anhand sichtbarer klinischer Merkmale (Phänotypen) und unterscheidet zwischen diagnostischen Major(Haupt)- und Minor(Neben)-Merkmalen. Zusätzlich existieren weitere Sonderformen:
- Rosacea fulminans: Maximalform mit plötzlichem („explosionsartigem“) Auftreten bei jungen Frauen zwischen 20-40 Jahre, hormonell getriggert
- Granulomatöse (lupoide) Rosacea: mit bräunlich-rötlichen granulomatösen Papeln und Knötchen sowie tiefen Entzündungen
- Medikamenteninduzierte Rosacea: durch langfristige Kortisonanwendung (topisch/systemisch) mit einer Kombi aus Papeln, Erythem, Atrophie, Teleangiektasien
- Gramnegative Rosacea: selten, durch gramnegative Bakterien nach Antibiotika-Langzeitbehandlung
- Morbus Morbihan: Mit persistierenden, nicht entzündlichen Mittelgesichtsödemen an Stirn, Augenlidern und Wange
- Extrafaziale Rosacea: als Red Scalp Syndrome auf Kopfhaut bzw. Red Scrotum Syndrome im Genitalbereich
Die individuelle Ausprägung kann stark variieren. Besonders schwere Verläufe mit Rhinophym wirken entstellend und bedürfen einer chirurgischen Therapie.
5. Differenzialdiagnose
Einige wichtige Differenzialdiagnosen sind:
- Acne vulgaris (mit Mitessern und Talgüberproduktion): Im Gegensatz zur Akne fehlen Mitesser, was ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellt.
- Periorale Dermatitis
- Seborrhoisches Ekzem
- Lupus erythematodes
- Kontaktallergien
- Phototoxische Reaktionen
Eine genaue Anamnese, die Erfassung möglicher Trigger und gegebenenfalls diagnostische Maßnahmen wie Hautabstriche, Dermatoskopie oder Biopsie helfen bei der Abgrenzung.
6. Ärztliche Therapie
Die Behandlung erfolgt in Stufen und orientiert sich dabei an Ausprägung und Form der Rosacea.
Primär finden topische Therapien Anwendung, darunter das antibiotische und antiparasitäre Metronidazol, Azelainsäure, Ivermectin gegen Entzündungen oder Brimonidin und Oxymetazolin gegen Erytheme.
Bei therapieresistenten und schweren Formen der Rosacea wird oft zusätzlich systemisch therapiert, mittels Tetracyklinen wie Doxycyclin oder Minocyclin oder mit dem Retinoid Isotretinoin („off-label“).
Zudem können Lasertherapien oder IPL zur Reduktion von Teleangiektasien und Rötungen erwogen werden. Ein Rhinophym wird chirurgisch mittels Laser, Skalpell oder Elektrochirurgie behandelt.
7. Empfehlungen für die Kosmetikerin
Wichtig ist zu beachten, dass bei Verdacht auf Rosacea der Kunde zur dermatologischen Abklärung motiviert werden sollte. Eine enge Zusammenarbeit mit einer dermatologischen Praxis kann außerdem hilfreich sein, um den Hautzustand langfristig zu stabilisieren.
Zwar dürfen Kosmetikerinnen keine medizinischen Therapien durchführen, aber sie übernehmen eine wichtige unterstützende Rolle. Kosmetische Behandlungen sollten besonders sanft und auf die sensible Hautstruktur abgestimmt sein. Auf reizende Verfahren sollte verzichten werden, darunter aggressive Peelings, Dampfanwendungen, Mikrodermabrasionen oder Massagen im betroffenen Areal.
Kunden können gezielt über mögliche Trigger informiert werden, und die Hautpflege sollte passend auf das Hautbild angepasst werden. Geeignete Pflegeprodukte kommen ohne Alkohole oder Duftstoffe aus und enthalten beruhigende Wirkstoffe wie Panthenol oder Bisabolol sowie zusätzliche Hautbarriere-stärkende Inhaltsstoffe. Auch ein täglicher UV-Schutz ist bei der Rosacea zu empfehlen.
Quellen:
https://register.awmf.org/assets/guide lines/013-065l_S2k_Rosazea_2022-
02.pdf
www.medizin.uni-tuebingen.de/puls-online/articles/ursachen-symptome-und-behandlungsmoglichkeiten
www.aerzteblatt.de/archiv/rosazea-teil-2-therapie-neue-aspekte-in-diagnostik-klassifikation-und-therapie-2174d0c7-5615-48dd-a4e2-3e02d970b040

Sarah White
Die Autorin ist angehende Ärztin, Kosmetikerin, Beauty Managerin (IHK), Autorin für Fachzeitschriften und Speakerin auf internationalen Kongressen sowie Gründerin der Marke „Iluqua“. www.iluqua.com