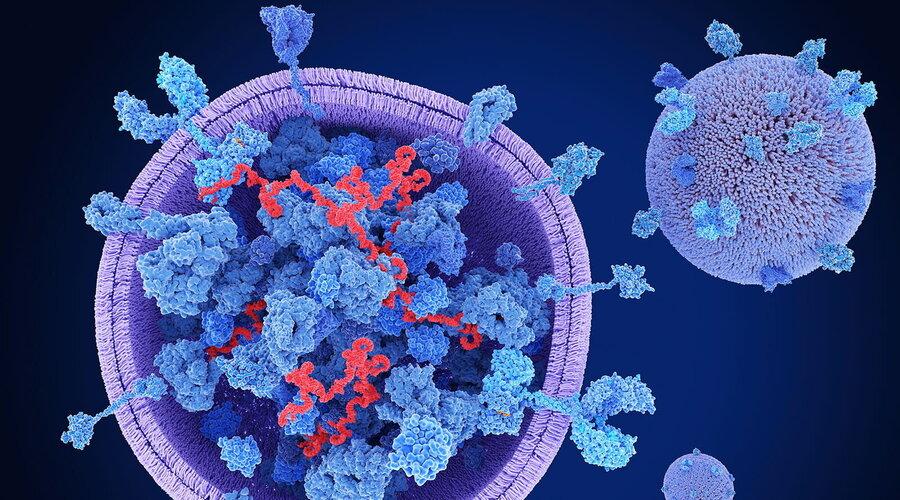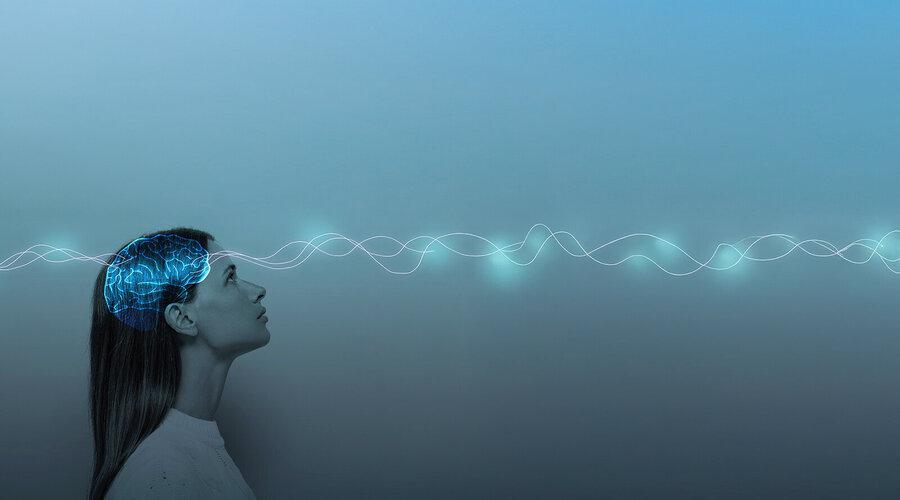Hyperpigmentierungen – besonders Altersflecken (Lentigines seniles) – gelten häufig als unästhetisch und werden als störend empfunden. Trotz zahlreicher medizinkosmetischer Therapieansätze und aktiver Wirkstoffkomplexe zur Pigmentaufhellung bleiben die Behandlungsergebnisse vielfach hinter den Erwartungen zurück. Die Behandlung sollte deshalb differenziert, synergetisch und nachhaltig erfolgen.
Melanin ist ein biologisch bedeutsames Pigment mit essenziellen hautphysiologischen Schutzfunktionen, insbesondere gegenüber ultravioletter Strahlung. Es handelt sich nicht um eine einzelne Substanz, sondern um ein komplexes Gemisch biopolymerer Verbindungen, das durch Me-
lanozyten in der Basalschicht der Epidermis synthetisiert wird.
Basierend auf ihrer chemischen Struktur lassen sich zwei Haupttypen differenzieren: Eumelanin und Phäomelanin. Die individuelle Hautfarbe ist das Ergebnis der spezifischen Zusammensetzung und Konzentration dieser beiden Melanintypen.
Studien zeigen, dass Menschen mit höherem Phototyp vermehrt Eumelanin bilden, während Phäomelanin – ein schwefelhaltiges, gelb-rötliches Pigment – vermehrt bei hellhäutigen, rothaarigen Individuen vorkommt.
Pathogenese
Hyperpigmentierungen resultieren entweder aus einer erhöhten Anzahl an Melanozyten oder einer lokal gesteigerten Melaninsynthese. Ein zentraler pathogener Trigger ist die UV-Strahlung, welche als wichtigste extrinsische Einflussgröße die Melanogenese stimuliert. Die daraus resultierende Hautbräunung stellt eine physiologische Schutzreaktion dar. Eine übermäßige UV-Exposition, insbesondere an prädestinierten Hautarealen wie Stirn, Nase, Wangen oder Handrücken – den sogenannten Sonnenterrassen –, führt häufig zur Entstehung persistenter Pigmentveränderungen.
Zusätzlich können photosensibili-sierende und photoallergische Arzneimittelreaktionen eine Hyperpigmentierung induzieren. Zu den relevanten Medikamentengruppen zählen unter anderem Chemotherapeutika, Antibiotika, Antiepileptika sowie Antidepressiva. Eine photosensibilisierende Wirkung setzt voraus, dass der Wirkstoff ein Chromophor enthält, in die vitalen Zellschichten penetriert und anschließend unter UV-Bestrahlung (insbesondere im UVA-Bereich) reaktive Sauerstoffspezies (ROS) generiert. Diese führen im weiteren Verlauf zur Melanozytenaktivierung und Hyperpigmentierungsbildung.
Behandlungen
Zur Behandlung von Dyschromien der Haut (Farbveränderungen durch Einlagerung von Pigmenten) gibt es eine Reihe an Verfahren und wirkstoffbasierten Lösungen:
- Microneedling und Mikroderm-abrasion
- Chemisches Peeling sowie Retinol
- der Einsatz von Vitamin C und weiteren Antioxidantien sowie Tyrosinase-Hemmern
Die therapeutische Strategie orientiert sich an der Art, Tiefe und Persistenz der Pigmentstörung. Während einige Hyperpigmentierungen gut behandelbar sind, zeigen sich andere therapieresistent oder rezidiv neigend. Eine Kombination aus verschiedenen Behandlungsansätzen hat sich in der Praxis bewährt. Die Therapie lässt sich in drei Stufen gliedern: Prävention, medizinisch-kosmetische Wirkstoffbehandlung und apparative Behandlungen.
1. Prävention
In Bezug auf eine homogene Pigmentierung der Haut kommt der Primärprävention, also der Verwendung von UV-Schutz, die wichtigste Bedeutung zu. Studienergebnisse zeigen, dass die regelmäßige Applikation von Sonnenschutzmitteln Dyschromien der Haut nicht nur vorbeugen, sondern auch verbessern kann. Ergänzend unterstützt ein an-
tioxidativer Zellschutz – etwa durch Vitamin E oder Q10 – die Prävention oxidativen Stresses, insbesondere bei Lentigines seniles.
Bei Patienten mit genetischer Disposition, Einnahme photosensibili-
sierender Medikamente oder chronisch-entzündlichen Dermatosen ist die Empfehlung eines UV-Schutzes unerlässlich.
2. Medizinisch-kosmetische Wirkstoffbehandlung
Ein effektiver Therapieansatz beruht auf der Kombination von Tyrosinaseinhibitoren, Antioxidantien, depigmentierenden sowie zellstimulierenden Wirkstoffen. So zeigten beispielsweise In-vitro-Studien zur Tyrosinase-Enzymaktivität, dass Hexylresorcinol einer der stärksten Tyrosinase-Inhibitoren ist.
Vor allem die Kombination von Hexylresorcinol und Niacinamid zeigte eine synergistische Verringerung der Melaninproduktion sowohl im Zellmodell als auch in Humanstudien. Die Kombination beider Wirkstoffe hat außerdem positive Effekte auf das Erscheinungsbildung von feinen Linien und der Festigkeit der Haut.
Pflanzenextrakte wie Boerhavia diffusa hemmen gezielt die Melaninsynthese und den Transport zu den Keratinozyten. Q10 reduziert oxidative Zellschäden. Vitamin C, Retinol und Süßholzwurzelextrakt tragen zur Depigmentierung bestehender Melaninflecken bei, während AHA (Alpha-Hydroxysäuren) die epidermale Regeneration fördern und die Pene-tration weiterer Wirkstoffe verbes-
sern. Diese Synergie kann sowohl bestehende Hyperpigmentierungen mindern als auch die Neubildung verhindern.
Eine langfristige Heimbehandlung in Kombination mit regelmäßigen professionellen Anwendungen (zum Beispiel Fruchtsäurebehandlungen) ist entscheidend für die Wirksamkeit. Ergebnisse stellen sich zumeist in den lichtarmen Monaten ein, wohingegen Sommermonate eine besondere He-rausforderung darstellen. Die Integration apparativer Verfahren kann die Effektivität zusätzlich steigern.
Aber nicht alle Hyperpigmentierungen lassen sich mit kosmetischen Methoden gleich gut behandeln: Die Behandlung von Melasmen gilt als besonders herausfordernd. Denn charakteristisch für ein Melasma ist eine geschädigte Basalmembran. Deshalb gelangen Melanozyten in die Dermis und führen zu einer konstanten Färbung der Haut. Ursache sind Östrogene in Verbindung mit Sonnenlicht, bei entsprechender genetischer Disposition oder ethnischer Veranlagung. Typisch ist ihr Auftreten während der Schwangerschaft und bei Einnahme von Kontrazeptiva.
Kosmetische Wirkstoffe stoßen hier an ihre Grenzen. Bei der Behandlung anderer, zum Beispiel postinflammatorischer Hyperpigmentierungen sind die Ergebnisse deutlich effektiver und nachhaltiger.
3. Apparative Behandlungen
Die Laserbehandlung gilt als Goldstandard in der Behandlung persistenter Hyperpigmentierungen. Abgestimmt auf Hauttyp und Pigmenttiefe kommen verschiedene Lasertechnologien zum Einsatz. Eine strukturierte Anamnese, präzise Diagnostik und ein individueller The-
rapieplan bilden die Basis der apparativen Behandlung.
Essenziell ist die adäquate Vor- und Nachsorge, insbesondere ein lückenloser UV-Schutz zwischen den Sitzungen, um das Risiko von Reizungen und Rezidiven zu minimieren.
Literatur:
Borelli, C., and S. Fischer. „Chemical Peelings zur Behandlung von Melasma, Pigmentstörungen und Hyperpigmentierungen: Indikationen, Effektivität und Risiken.“ Hautarzt (2020): 950–959.
Fatima, Sakeena, et al. „The role of sunscreen in melasma and postinflammatory hyperpigmentation.“ Indian journal of dermatology 65.1 (2020): 5.
Kaufman, Bridget P., Taulun Aman, and Andrew F. Alexis. „Postinflammatory hyperpigmentation: epidemiology, clinical presentation, pathogenesis and treatment.“ American journal of clinical dermatology 19.4 (2018): 489–503.
Kanlayavattanakul, Mayuree, and Nattaya Lourith. „Plants and natural products for the treatment of skin hyperpigmentation–a review.“ Planta medica 84.14 (2018): 988–1006.
Nautiyal, Avni, and Sarika Wairkar. „Management of hyperpigmentation: Current treatments and emerging therapies.“ Pigment cell & melanoma research 34.6 (2021): 1000-1014.
Phansuk, Kachanat, et al. „Dermal Pathology in Melasma: An Update Review.“ Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 15 (2022): 11.
Rathee, Prity, et al. „Skin hyperpigmentation and its treatment with herbs: An alternative method.“ Future Journal of Pharmaceutical Sciences 7 (2021): 1–14.
Schalka, S. „New data on hyperpigmentation disorders.“ Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 31 (2017): 18–21.
Shariff, Rezwan, et al. „Superior even skin tone and anti-ageing benefit of a combination of 4-hexylresorcinol and niacinamide.“ International Journal of Cosmetic Science 44.1 (2022): 103–117.
Vashi, Neelam A., and Roopal Vashi Kundu. „Facial hyperpigmentation: causes and treatment.“ British Journal of Dermatology 169 (2013): 41–56.
Woolery-Lloyd, Heather, and Jenna N. Kammer. „Treatment of hyperpigmentation.“ Seminars in cutaneous medicine and surgery. Vol. 30. No. 3. WB Saunders, 2011.

Anna Holling-Tersteeg
Die Autorin ist Kosmetikwissenschaftlerin und staatlich geprüfte Kosmetikerin. Sie hat die Leitung PR, Kommunikation und KosWis-Strategie bei Medicos Kosmetik/Aesthetico. www.aesthetico.de