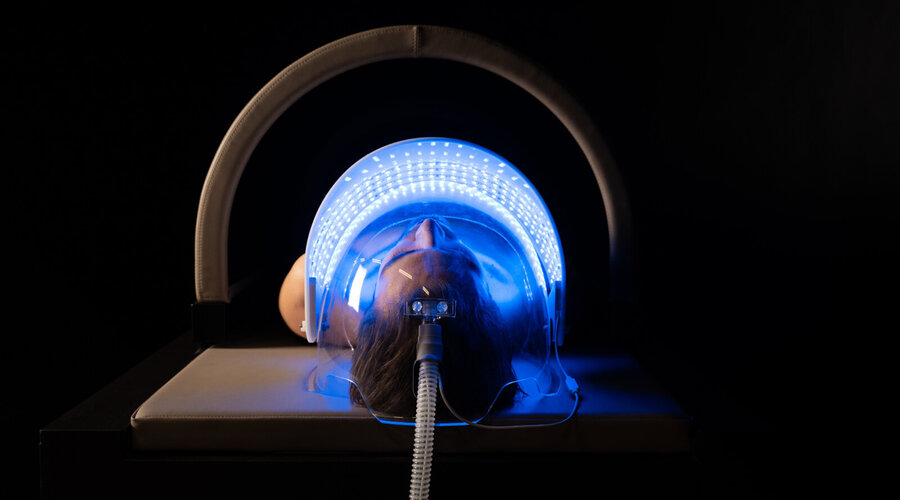Die Zukunft vorauszusagen heißt, einen Blick in die Glaskugel zu wagen. Je nach Blickwinkel, sprich dem Horizont des Blickenden, sind unterschiedliche Vorstellungen zu erwarten. Das gilt auch für den folgenden Blick eines Kosmetikherstellers.
Schaut man auf die Zahlen des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel (IKW), dann nimmt das Volumen der an die Frau und den Mann gebrachten Kosmetika kontinuierlich zu. Selbst die Corona-Krise hat diesem Trend offensichtlich nicht geschadet. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Trend in Zukunft fortsetzt. Das Angebot von Produkten und Behandlungen ist allerdings ständigen Änderungen unterworfen. Was ist im Einzelnen zu erwarten?
Technologische Innovationen
Große Aufmerksamkeit erhalten neue Technologien, wobei zu unterscheiden ist zwischen verbalen, rein marketingtechnischen und substanziellen Innovationen.
Zu Ersteren gehören beispielsweise die Exosomen, bei denen es sich um Vesikel handelt, die Zellbestandteile und Informationen enthalten und diese in Form von Proteinen und Nukleinsäuren aus Zellen heraus an andere Orte innerhalb lebender Organismen transportieren. Sie sind naturgemäß Bestandteile von pflanzlichen Präparationen. Das ist nicht wirklich neu, zeigt aber, dass gegenwärtig und zukünftig die physika-lischen Eigenschaften von Kosmetika, hier in Form von kleinen Teilchen, ohne Zweifel weiter eine große Rolle spielen. Denn dahinter steckt die Optimierung der Verfügbarkeit von Wirkstoffen sowohl pflanzlicher als auch anderer Provenienz gleichermaßen.
Zu den technologischen Innovationen gehört ebenso die optimierte Zugänglichkeit von Naturstoffen durch chemische Synthese.
Bei näherer Betrachtung liegen die eigentlichen Innovationen zuweilen schon Jahre zurück und erleben ihre Umsetzung erst nach langsamem Beginn beschleunigt in die Zukunft hinein – zu sehen beispielsweise bei lamellaren, konservierungsstofffreien oder wasserfreien Präparaten.
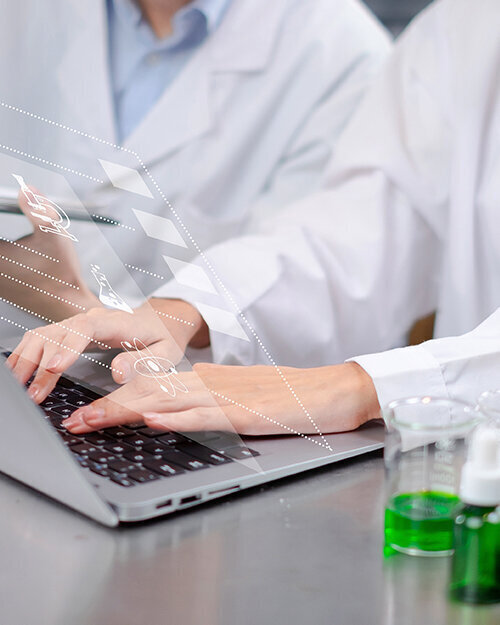
Zu den technologischen Innovationen gehört auch die optimierte Zugänglichkeit von Naturstoffen durch chemische Synthese.
Modetrends
Kosmetika folgen Modetrends. Das betrifft nicht nur den Dekobereich, der sich sowohl kurzfristig saisonal
als auch mittelfristig in einem etwa Drei-Jahres-Rhythmus ändert, sondern auch Behandlungstrends, die mitunter im Zusammenhang mit ästhetischen, körperlichen Veränderungswünschen stehen. Denn kleine und größere ästhetische „Modellierungen“ boomen. Dementsprechend wächst der Stellenwert der präventiven, adjuvanten und nachsorgende Pflege in gleichem Maße.
Hierauf sollten sich die Kosmetikinstitute wissensmäßig einstellen, um synergistische Behandlungen durchführen und geeignete Empfehlungen geben zu können.
Im Vordergrund stehen dabei antiinflammato-rische, antimikrobielle, adstringierende, barriereaktive, regenerative und gegen Hyperpigmentierung wirksame Stoffe in Form von Seren oder verarbeitet in Cremes.
Kultureinflüsse
Die Kultur, das heißt, wie wir individuell mit unserem Körper umgehen, verändert sich fast unmerklich, aber kontinuierlich und wird in ihren Auswirkungen erst in längeren Zeiträumen sichtbar. Ein Beispiel ist das ansteigende Hygieneverhalten. Dass insbesondere die Immunisierung von Kleinkindern bei Übertreibung darunter leidet, ist ein offenes Geheimnis. Die sich weiter fortsetzende Zunahme von Allergien und dermalen Sensibilitäten wie etwa der atopischen Haut sind statistisch belegt.
Gern wird in diesem Zusammenhang auf aggressive Umwelteinflüsse alias Exposom und dagegen schützende Präparate hingewiesen. Fakt ist aber, dass die realen Belastungen mit Rückblick in die Vergangenheit speziell in Europa immer mehr zurückgehen.
In die Kosmetik übersetzt sind Präparate, die gegen das Exposom wirken, nichts anderes als angewandter Hautschutz, der sich jedoch in den letzten beiden Jahrzehnten verändert hat. Die ursprüngliche Philosophie eines okklusiven Schutzschilds ist einer ausgeglichenen Balance zwischen Barriereintegrität und maximal geförderter Regenerationsfähigkeit gewichen.
Allerdings kann man feststellen, dass sich die vollständige Umsetzung der damit verbundenen Erkenntnisse in der Praxis noch in die Zukunft hineinziehen wird. Der Schwerpunkt des reinen Hautschutzes liegt nach wie vor im gewerblichen Bereich.
Schadstoffe
In diesem Zusammenhang wird auch in Zukunft kein Tag vergehen, an dem durch die Medien nicht auf neue schädliche Stoffe innerhalb der Exposom-Thematik inklusive deren Vorkommen in kosmetischen Präparaten hingewiesen wird.
Diese Meldungen gehen entweder auf gezielte Warentests oder grundlegende wissenschaftliche Untersuchungen zurück. Eines ist vielen gemeinsam: Sie erzeugen Unsicherheit, sind aber real meist nicht von Bedeutung, da in der Aufregung regelmäßig die Konzentrationen und ihre Verfügbarkeit ausgeblendet werden. Schon Paracelsus wusste es besser: Erst die Dosierung alias Konzentration macht, dass ein Stoff ein Gift ist.
Dazu Beispiele aus der Vergangenheit. Porzellanerde (Kaolin) ist ein häufiger Bestandteil mineralischer Masken und Make-ups. Es enthält praktisch immer Blei, das aber nicht freigesetzt wird. Blaulicht, von Mobiltelefonen oder ähnlichen Geräten ausgestrahlt, erzeugt Radikale, deren Konzentration zu anderen täglichen Quellen vernachlässigbar klein ist.
Andererseits folgen gesetzliche und regulative Festlegungen zu Beschränkungen und Verboten von Stoffen, aber auch Behandlungstechniken mit Verzögerung den wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Auch hier zwei Beispiele: Diethylphthalat (Weichmacher) ist nach wie vor Bestandteil des Alcohol Denat.(INCI), während kürzlich Dihexylphthalat (ebenfalls Weichmacher) als Verunreinigung des UV-Filters Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (INCI) im ppm-Bereich in die Schlagzeilen der Medien gekommen ist.
Asbestanteile im Talkum machen auch immer wieder die Runde, obwohl doch durchweg alle (!) mineralischen lungengängigen Partikel ein Problem darstellen, also nicht nur der Asbest, der womöglich in ihnen enthalten ist. Um derartige Informationen richtig einordnen zu können, ist es wünschenswert, dass alle Beteiligten zukünftig noch besser ausgebildet sind.
Wissenschaft
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere zu den biochemischen Abläufen in der Haut und zur dermalen Biophysik, entwickeln sich rasant. Sie haben Einfluss auf den Einsatz alter und neuer Wirkstoffe, deren Konzentrationen und ihrer Verpackung in geeigneten Grundlagen. Das bis vor einigen Jahren ein Schattendasein führende Mikrobiom hat sich als ein Schlüssel für die Verträglichkeit von Kosmetika herausgestellt. Hier werden sich immer mehr Präparate durchsetzen, die sich nahtlos in die physiologischen Abläufe einfügen und ohne Hilfsstoffe auskommen. Sie entsprechen dann sowohl den Erfordernissen der Epidermis als auch des Mikrobioms. Dabei stehen insbesondere leicht abbaubare, vermehrt wasserfreie Präparate im Vordergrund, die niedrig dosiert angewandt werden.
Wirkstoffe
Ein Thema, das die Branche ständig bewegt, sind die Wirkstoffe der Zukunft. Man kann vermuten, dass der Trend zu Stoffen anhält, die spezifische biochemische Reaktionen induzieren, beschleunigen, bremsen oder blockieren.
Dabei geht es zum Beispiel um die Beeinflussung des Kollagen- und Hyaluronsäure-Haushalts oder um die Nutzung antientzündlicher Metaboliten von Naturstoffen. Metaboliten sind vielfach synthetisch zugänglich und haben sich bereits in der Vergangenheit im Vergleich zur Isolierung der eigentlichen Naturstoffe wie etwa Wachstumsfaktoren als eleganter und wirk-
samer herausgestellt.
Ein Dauerbrenner ist die weitere Perfektionierung des Strahlungsschutzes – dabei sind marketingtechnische Übertreibungen unter Vernachlässigung der körpereigenen Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen. Hinsichtlich des molekularen Aufbaus werden Fettsäureabkömmlinge und Oligopeptide weiterhin die Nase vorn haben.
Aber auch Zellbestandteile aus der Gruppe der Phospholipide und Nukleotide werden weiter im Fokus bleiben. Im Sinne der maximalen Verfügbarkeit von Wirkstoffen wird der Ersatz physiologischer Penetrationsverstärker zunehmen.
Sicherlich werden unter den etablierten Wirkstoffen weitere Konkurrenten auftreten wie etwa bei den Antioxidantien. Sie dienen allerdings eher dem Marketing, da man ihre Funktion bei den Verwendern als bekannt vo-raussetzen kann und so mit der Steigerung ihrer numerischen Effektivität geworben wird.
Substanziell und wissenschaftlich gesehen darf man sie allerdings als eher uninteressant einstufen.
Cosmeceuticals
Die Verwendung und Einordnung von kosmetischen und pharmazeutischen Wirkstoffen zeigen zunehmend Grenzüberschreitungen. Die Etablierung und Weiterentwicklung der Klasse der Cosmeceuticals ist ein typisches Beispiel für eine Nischenentwicklung. Hinsichtlich etwaiger Nebenwirkungen, die sich dabei ergeben können, werden die physiologische Kompatibilität und die Bewertung innerhalb des von der Kosmetikverordnung geforderten Sicherheitsberichts eine immer größere Bedeutung gewinnen. Beispiele sind Antimykotika, die zur Schuppenbehandlung eingesetzt werden, sowie Azelainsäure (Akne, Rosacea) und Tranexamsäure (Hyperpigmentierung).
Nahrungsergänzungsmittel
Sind Nahrungsergänzungsmittel in der Vergangenheit eher ein ergänzendes Verkaufsangebot gewesen, kommt ihnen unter dem Gesichtspunkt „Zielorgan Haut“ in der oralen Verabreichung eine zunehmende Bedeutung zu, auch wenn heute noch die meisten Wirksamkeitsstudien von zweifelhaftem Wert sind, da sie zwar in wissenschaftlicher Aufmachung erscheinen, es aber nicht sind.
Ökologie
Ökologische Bedingungen verändern sich lokal und weltweit. Dabei spielen zunehmend die Erzeugung und die Lieferketten von Kosmetikbestandteilen eine Rolle. Prospektiv ist davon auszugehen, dass es zunehmend zu Einschränkungen, verschärften Importregelungen und damit zwangsläufig zur Umstellung auf Substitute kommen wird.
Es stellt sich mit anderen Worten die Frage, welche Inhaltsstoffe von Kosmetika zukunftsfähig sind. Dabei geht es vor allem um die Vermeidung von Monokulturen im Anbau, die der Diversität von Pflanzen und heimischer Fauna sowie dem Klima schaden. Im Fokus werden vermehrt Öle, Fette und deren Nebenprodukte stehen, die bei ihrer Gewinnung anfallen. Sich damit intensiv zu beschäftigen, ist vor allem die Aufgabe der Kosmetikentwickler.
Preisgestaltung und Vertriebskanäle
Die Kosten bei Produktion und Vertrieb von Kosmetika steigen nach wie vor und bewirken zusammen mit der jährlichen Inflationsrate eine steigende Belastung für die Verbraucher. Diese Tendenz führt zusammen mit individuellen minimalistischen Zielen zu einer erhöhten Fokussierung auf die Nachhaltigkeit und Langzeit-effektivität von Kosmetika.
Hinsichtlich der Kosmetikinstitute etablieren sich parallele Online-Shops einerseits der Hersteller, andererseits der Kosmetikinstitute und der dermatologischen (Kombi-)Praxen. Damit verbunden ist eine stärkere im Netz sichtbare Konkurrenz und eine Abnahme der persönlichen Beratung durch Verkaufsgespräche und Institutsbehandlungen.
Trotz steigender Online-Präsenz oder vielleicht gerade deshalb wird die Personalisierung von Präparaten und Behandlungen zu einem entscheidenden Faktor in der Zukunftsfähigkeit der Institute. Auch die Konzentration auf Nischen im dermatologischen Bereich mittels spezieller Private-Label-Zusammensetzungen trägt dazu bei.
Die verkaufsfördernde Komponente in Form von Siegeln wird zunehmend genutzt, um den Verbrauchern die Entscheidung zu erleichtern. Die kritischen unter ihnen stellen allerdings mehr und mehr fest, dass es sich bei den Siegeln vor allem um ein käufliches Marketinginstrument handelt.
Künstliche Intelligenz
Die Algorithmen künstlicher Intelligenz nehmen zunehmend Einfluss auf alle Bereiche der Kosmetik, angefangen bei der Hautanalyse. Neben intelligenten Softwarelösungen, in denen Präparate mit Hautkonditionen korrelieren, gibt es bisher keine selbstlernenden Konstruktionen, obwohl dies besonders bei modularen Systemen in der personalisierten Hautpflege wünschenswert wäre. Das hängt damit zusammen, dass einerseits entsprechend notwendige Daten von Einzelstoffen fehlen und andererseits deren Kombinationen untereinander komplexe Interaktionen beinhalten.
Man ist daher auf Abschätzungen angewiesen, die aber vermutlich mit der Zeit immer genauer werden. Das heißt, bei der Lernfähigkeit ist noch der Mensch gefragt, der die Ergebnisse dann auf die Maschine – sprich Software – übertragen muss. Dabei ist es besonders wichtig, subjektive und versteckte marketingtechnische Einflüsse zu unterbinden.
Die Korrelation gentechnischer Analysen mit Behandlungskonzepten steckt ebenfalls erst in den Kinderschuhen und zeitigt gegenwärtig noch keine substanziell verwertbaren Resultate.

Dr. Hans Lautenschläger
Der promovierte Chemiker ist seit 1998 geschäftsführender Gesellschafter der Koko Kosmetikvertrieb GmbH & Co. KG in Leichlingen und spezialisiert auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb physiologischer Hautpflegemittel. www.dermaviduals.de